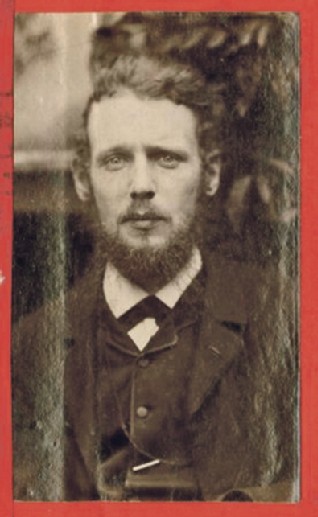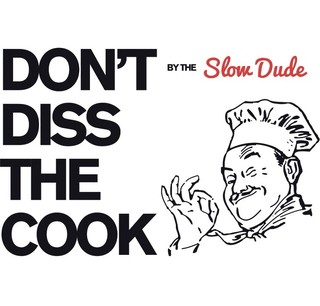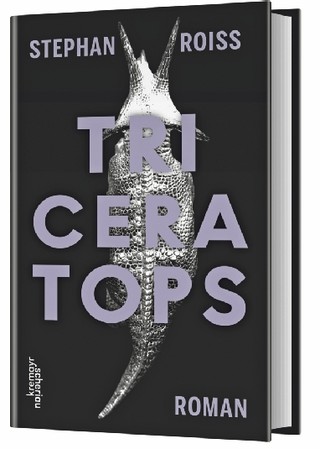A Good Laugh
Die Referentin #21
Ein Montagabend Ende August 2020. Ist es noch zu früh für einen Rückblick auf dieses völlig aus den Fugen geratene Jahr? Ich mein, wer weiß, was da noch kommt? Oder nicht mehr kommt? Ich bin auf dem Weg nach Hause nach einem Abend, der sich mehr zufällig als verabredet ergeben hat. Mit Menschen, die ich sehr mag und die ich sehr lange nicht gesehen habe. Die genauso intensiv, leidenschaftlich, ihrer Sache gewiss und in allem sehr kräftig und „viel“ waren wie ich. Die in den letzten Monaten genauso ruhig und leise geworden sind wie ich (wie sehr mir mittlerweile laute Menschen auf die Nerven gehen, merke ich). Gespräche über diejenigen, auf die wir künftig verzichten wollen und über die, die wir gerne öfter in unserer Nähe hätten. Ein Gespräch auch über tote Freunde, die wir immer noch fürchterlich vermissen. Ein Gespräch auch über Linz, und wie wir es hassen, aber meine Güte, da sind wir halt gestrandet und warum und wohin sollten wir jetzt noch gehen. Wir haben es hässlich gesehen, wir haben es aufgeputzt gesehen, wir haben gesehen, wie die Wichtigtuer sich der Stadt und seiner Kunst und Kultur bemächtigt haben und wir haben uns zugesehen, wie wir dabei immer etwas „weniger“ wurden und werden – und wie gut uns das überraschenderweise tut. („Doch all die Menschen, die ich wirklich wirklich gerne mag, sie sind genauso außer Atem wie ich“1 klingt es im Ohr). Die Landstraße ist fast leer und ich weiß, ich muss noch einen, diesen Text nämlich schreiben, den ich am Nachmittag begonnen hab. In dem sollte es eigentlich um das Lachen gehen, den „good laugh“, wie er in Filmen und Screenscripts wie jenem von Ernst Lubitsch und Edwin Justus Mayer verfassten To Be or Not to Be aus dem Jahr 1942 stattfindet. Ein „good laugh“, der so böse und makaber ist, dass man ihn kaum aushält. Ein Lachen, das etwa entsteht in einer Szene mit einem enganliegenden, weißen, schimmernden Abendkleid, das Carole Lombard als Maria Tura trägt. „How do you like my dress?“ fragt sie Dobosh, den Produzenten des Stücks „Gestapo“, das die polnische Theatergruppe im Film gerade probt. Dobosh fragt sie, ob das das Kleid ist, das sie in der Szene im Konzentrationslager tragen will. „Think of me being flogged in the darkness“, antwortet Tura/Lombard, “I scream, the lights go on and the audience discovers me in this gorgeous dress.” Ein Schauspielerkollege namens Greenberg, der einzige in Lubitschs Film, dessen Name eindeutig auf jüdische Wurzeln referiert, pflichtet ihr bei und meint, das würde einen „terrific laugh“ evozieren. Es ist bei weitem nicht die einzige Szene in dieser Komödie, die mit Zweideutigkeit Lacher erzeugt, Lacher, die Unbehagen hervorriefen, die bereits bei der Uraufführung des Films für Kritik sorgten. Wie könne man in den USA eine Komödie produzieren über das unaussprechliche Leid, das Menschen in Polen und ganz Europa unter den Nationalsozialisten zur selben Zeit erfuhren? Lubitschs Antwort darauf war deutlich: “It seemed to me that the only way to get people to hear about the miseries of Poland was to make a comedy. Audiences would feel sympathy and admiration for people who could still laugh in their tragedy.”2 Sympathy and admiration, Sympathie und Bewunderung zu erzeugen für die Leidtragenden und Opfer waren die Motive, die Lubitsch leiteten, die es ihm erlaubten, einen der lustigsten Filme über eines der mörderischsten Regime zu drehen. „A good laugh“ – wir sprechen achtzig Jahre später wieder darüber, worüber wir lachen wollen und dürfen, was lustig ist, was gescheit ist – und was einfach nur offen rassistisch und antisemitisch. Und es tut weh, dass wir angesichts der patscherten Versuche von Rechten, sich der Kategorie „Humor“ anzunehmen, überhaupt darüber reden müssen, was ein „guter Witz“ und was offener Rassismus und Antisemitismus ist. Die Altherrenriege, die aktuell einer Kabarettistin zu Hilfe eilt, weil sie deren Mitgliedern mit Schenkelklopferwitzen Ablenkung und Ausweg verspricht aus der Komplexität eines guten, mehrdeutigen Witzes, wie ihn Ernst Lubitsch und Edwin Justus Mayer schreiben konnten, bestätigt bloß eines: Europa war spätestens nach 1945 seiner Intelligenz und Humanität, seines Witzes, seiner Ambiguität verlustig gegangen und die meisten von uns, die wir hier und heute darüber diskutieren, was „a good laugh“ ist, tun dies in der Position von Nachkommen von Mitläufer*innen und Täter*innen – und nicht als Nachkommen von Opfern des Nationalsozialismus. Was eventuell erklärt, aber keineswegs entschuldigt, warum wir akzeptieren, dass ein Witz keine politischen Machtverhältnisse mehr kritisiert, sondern nur noch auf Kosten derer funktioniert, die sich nicht wehren können. Witze, die keineswegs „sympathy and admiration“ hervorrufen sollen, sondern einfach nur billige Lacher erzeugen, indem man auf „die da unten“ tritt.
Über Dinge wie diese hätte es gehen sollen, in dieser Kolumne und nun ist es spät nachts und ich begegne der Frau mit dem vollen Einkaufswagen, die immer sehr gschaftig und auch unfreundlich ist, wenn sie ihn über die Landstraße schiebt. Eine Frau, über die sich viele lustig machen, wenn sie sie sehen, auch weil sie sehr herrisch und selbstbewusst die Leute anblafft, wenn sie ihr im Weg stehen. Sie muss auch noch arbeiten, denk ich, als ich sie sehe, sie muss auch noch ihren Karren über die Landstraße schieben und hat irgendeinen Auftrag, von dem keiner was weiß. Ich erinnere mich an den Freund, den ich am Nachmittag getroffen hab, der seinen Kinderwagen vor sich hergeschoben hat, der mir erzählt, wie es ist, als Mann in Karenz, dass er eigentlich gar nicht mehr kann und kaum noch schläft und ich denke an meinen eigenen Sohn, und wie arg die Zeit war, als ich ihn über die Landstraße geschoben hab und nicht wusste, wie sich das alles ausgehen soll und ich mal wieder schlafen kann und an den Freund, der mir am Abend erzählt, dass er praktisch 100% Lohnausfall hatte die letzten Monate und ich denke an die Künstlerin, die ich am Vormittag getroffen hab und die meinte, dass wir als Spezies es wohl grade ziemlich versemmeln. Und ich denke daran, dass wir alle nicht so genau wissen, wie sich das alles noch ausgehen kann und wird. „A good laugh“ – das wär’s, denke ich, und daran, dass wir es allerdings womöglich nicht mehr schaffen werden, aus all dem eine richtig gute, böse, zweideutige, komplexe, mit geschliffenen Dialogen versehene Komödie zu machen.
1 Gisbert zu Knyphausen, Sommertag, 2008
2 David L. Smith, To be or not to be, www.loc.gov
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(19. Januar 2026)