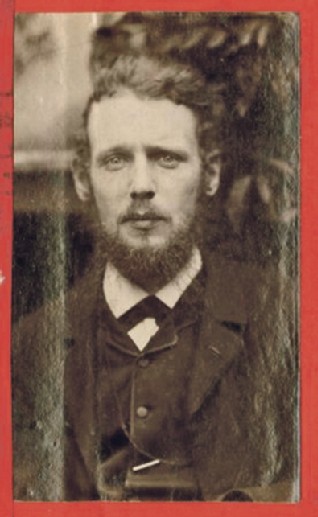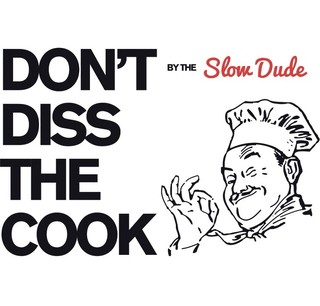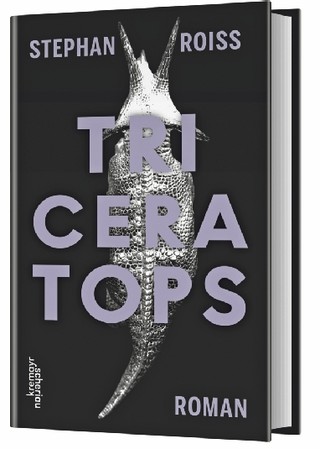Digitalia Theater: Ephemer, exklusiv, jetzt.
Die Referentin #21
Was Corona mit der deutschsprachigen Theaterwelt auf jeden Fall gemacht hat, ist die so genannte Streaming-Debatte vom Kopf auf die Füße und als Tatsache in die Realität gestellt zu haben. Theresa Gindlstrasser reflektiert Erfahrungen mit Theater-Onlineformaten, die während des Lockdowns gelaufen sind.

Theater im Netz: Statt Applaus ohne Ende rauchen. Foto Elisabeth Schedlberger/Thomas Scharl
Es war einmal Anfang März. Da war ich auf Kampnagel. Auf dem Gelände des internationalen Produktionshauses in Hamburg sollte eine Weiterbildungs-Akademie betreffs Zeitgenössischer Theaterjournalismus stattfinden. Inklusive vieler Theaterbesuche. Aber dann kam es, wie es kam – und zwar Lockdown. Wir sprachen mit verzweifelten Künstler*innen, besichtigten leere Hallen und eine letzte, allerletzte Vorstellung, waren irgendwann dann gefühlt alleine am riesengroßen ehemaligen Maschinenfabrik-Areal und drehten Samstagabend, den 14. März, die Lichter hinter uns ab. Wir Theaterjournalist*innen waren nicht minder verzweifelt: Was ist denn bitte Zeitgenössischer Theaterjournalismus ohne Theater? Und die darauffolgenden Fragen zwei und drei: Was schreiben? Wovon leben?
Frage Nummer drei, die ökonomische, bleibt weiterhin bestehen. Aber das Theater ist ja ein Fuchs. Oder ein Phönix. Was in Linz umso mehr stimmt, aber in dem Fall meine ich nicht das Linzer Theater, sondern die Auferstehung aus der Asche. Denn noch am selben Wochenende Anfang März startete das Online-Theaterportal Nachtkritik.de mit dem Streamen von Vorstellungen. Andere Häuser und Institutionen reagierten ebenso prompt. Was Corona mit der deutschsprachigen Theaterwelt auf jeden Fall gemacht hat, ist die „Streaming-Debatte“ vom Kopf auf die Füße bzw. als Tatsache in die Realität gestellt zu haben. Streaming-Debatte? Nun! Das Theater bildet sich, sehr zu Recht, was darauf ein, Live-Kunst zu sein. Ephemer, exklusiv, jetzt. Und ergänzte bis dato nur bedingt oder nur vereinzelt die Live-Präsenz um einen Stream. Diese Debatte besteht aber nicht ausschließlich aus ideologischen Bedenken. Ist doch die Rechtslage zwischen Theatern, Verlagen und Kunstschaffenden kompliziert und die Frage nach Tantiemen ökonomisch wichtig.
Seit 2013 veranstalten Nachtkritik.de und die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin jährlich die „Theater&Netz“-Konferenz zu genau diesen Themen. Dort wird, quasi zwischen Theatertreffen und Re:publica, über Möglichkeiten und Notwendigkeiten im Zusammenspiel von Darstellender Kunst und Digitalität diskutiert. Auch diese Veranstaltung konnte 2020 nicht in der geplanten Form stattfinden. Inhalt „Digitalität“ und Format „Live“ – das ging sich nicht aus. Stattdessen gab’s von 17. bis 19. April eine Veranstaltung namens Der erste Weltübergang-Hackathon. Theatermacher*innen, Game-Designer*innen und Hacker*innen arbeiteten sich auf Video- und Chatplattformen an der Frage ab: „Wie können wir uns auch online miteinander verbinden?“ Eine dazugehörige Website versammelt Ergebnisse, Ideen und Anknüpfungspunkte. Auf dass der Entwicklungsschub ein nachhaltiger sei.
In der Vorbereitung zu diesem Text kam es übrigens zu einem witzigen und wahrscheinlich paradigmatischen Moment zwischen der Redakteurin Tanja Brandmayr und mir. Der Mail-Verkehr ging ungefähr so: „Bitte beim Online-Hot-Shit trotzdem auf Linz und Lokalität achten“ – „Mir fällt kein Projekt ein, das während Corona von Linz aus ins Digitale gegangen wäre“ – „lokal und digital“ – „haha“. Genau das! Wenn das Theater sich ins Internet streamt, dann muss ich mir kein Zugticket checken, um diesen einen herausragenden Abend in Frankfurt, Zürich oder Bregenz sehen zu können, meine Kaufkraft und Mobilität werden nicht in Anspruch genommen, außerdem kann ich während des Schauens rauchen – es lebe die Demokratisierung der Zugänge zur Kunst! Oder ist das gar keine Demokratisierung, sondern bloß Ver-Nerd-isierung? Wer in Linz braucht denn bitte Theater in München?
Apropos München! Und das hier ist die Überleitung vom Streamen von vorgefertigten bzw. live übertragenen Bühneninszenierungen hin zu genuinen Online-Formaten, die während der Zeit des Lockdowns nicht minder prompt von den Rändern der Theaterwelt ins Zentrum der Aufmerksamkeit katapultiert wurden. Gro Swantje Kohlhof, Schauspielerin im Ensemble der Münchner Kammerspiele, startete kurz nach Einstellung des Spielbetriebs ihre vielteiligen „Hogwarts Exkursionen“. Per Zoom spielte sie, in ihrem Hamburger Kinderzimmer-Kleiderschrank sitzend, immer mittwochs um 18 Uhr „Harry Potter“ nach. Sie verwandelte die eigene Lockdown-Depression in Harrys Missmut bei den Dursleys unter der Treppe oder verzauberte ihre zwei Katzen plus Kuscheltier zum dreiköpfigen Hund. So schnell hatten die Münchner Kammerspiele ihren charmanten DIY-Online-Spielplan. Zu dem das Landestheater Linz zum Beispiel bis zuletzt nicht kam.
Ich bleibe, wenn schon nicht lokal, so zumindest in Österreich, wenn ich schreibe: Die für immersive Spiel-Anordnungen bekannten Gruppen Nesterval (aus Wien) und Planetenparty Prinzip (aus Graz) wanderten mit ihren Projekten während des Lockdowns mehr oder weniger problemlos ins Internet aus. Da wurde per Konferenzschaltung und über mehrstufige Fragerunden ein neuer sozialdemokratischer Hoffnungsträger gewählt. Oder über die Steuerung eines Live-Avatars ein Mordfall gelöst. Dagegen war das Burgtheater mit seiner Wiener Stimmung recht antiquiert unterwegs: Autor*innen schreiben, Schauspieler*innen spielen und User*innen sehen schnörkellose Videos. Halt alles nicht so geil wie Netflix. Und auch nicht so geil wie in Real Life. Wieso? Weil diese Texte, dieses Spiel und diese Ausstattung ein Live-Format 1:1 im Virtuellen versuchten. Weil leibliche Ko-Präsenz von Akteur*innen und Publikum, also die theatertheoretisch vielbeschworene Feedback-Schleife, vor dem Bildschirm so nicht funkt. Es funkt dann, wenn irgendeine Art von Interaktion stattfinden kann. Wenn es dem Geschehen da vorne auf der Bühne oder da drinnen im Netz nicht wurscht ist, dass ich da bin. Da gilt es, digitale Übersetzungen zu finden, für „ephemer, exklusiv, jetzt“. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Kollektive, die immer schon mehr mit dem Herstellen einer gemeinsamen (Gaming-)Situation als mit dem Darstellen eines bestimmten Handlungsablaufs beschäftigt waren, sich problemloser auf die in dieser Hinsicht verschärften Anforderungen von Theater im Internet einstellen konnten.
Der Online-Spielplan des Burgtheaters war aber umfassender als die genannten Videos. Am 12. Mai wurde unter #vorstellungsänderung zum Twitter-Theaterabend geladen. Heißt: Wir sollten twittern, als ob wir im Theater eine Vorstellung besuchen würden. Inklusive gestresstem Pinkeln beim Klingelzeichen und Hustenzuckerl-Raschlerei. Es war aufregend! Nämlich mein erster journalistischer Arbeitsauftrag seit Anfang März. Ich durfte eine Kritik schreiben, über einen „Theaterabend, der gar nicht stattfindet“, zu einem „Stück, das gar nicht existiert“, in einem „Theater, das gar nicht geöffnet haben darf“. Weil, es gab nämlich kein Theater oder besser gesagt: Das Theater entstand als Twitter-Gewitter, war der Entstehungsprozess selbst. Die Vorstellung, also die Theateraufführung, geschah als Vorstellung, also als Imagination. „Wir zusammen“, schließlich hieß es „Regie: Via Zusamm“, machten uns eine Vorstellung, nicht ausgehend von irgendwelchen vor uns hin gestageten Vorgängen, sondern andersherum: Indem wir vorstellten, stand es auf Twitter zu lesen und war also kein Fake. In diesem Absatz steht nun sehr oft „wir“– und darum ging’s bei #vorstellungsänderung auch ausdrücklich und darum geht’s im Theater ja immer: Dass das etwas ist, das „wir“, Akteur*innen und Publikum und Techniker*innen (undundund) gemeinsam tun.
Einzig offene Frage: Wie geht Applaus im Internet? Alleine vor dem Laptop in die Kamera klatschen fühlt sich vor allem bescheuert an, einfach die Konferenz-Schaltung beenden, den Live-Stream schließen oder aus Telegram aussteigen noch viel mehr. Zu applaudieren, das ist ja nicht nur Gradmesser der Publikumsgunst, das ist auch Rahmung des Ereignisses „Theater“. Beim Klatschen findet ein Übergang statt, von einer Art Wirklichkeit in die andere. Oder zumindest ist es der zeitliche Marker, an dem wir die Räumlichkeit verlassen. Eine Räumlichkeit, an der wir grade irgendwas gemacht, gedacht, gehört oder gesehen haben. Das Internet aber kann vergleichzeitigen und vergleichörtlichen: Ich muss nie aufhören zu rauchen. Was wäre dann ein adäquater Übergang? Ich weiß es nicht. Weiß aber schon, dass, als ich am 16. Juli zum ersten Mal wieder in einem Theatersessel saß, beim Applaus gar nicht aufhören wollte, weil mir die Selbstverständlichkeit bezüglich dieser spezifischen Bewegung während der vier theaterfreien Monate abhanden gekommen war.
Sowieso gibt es noch jede Menge anderer offener Fragen. Zum Beispiel: Und was nun? Die Salzburger Festspiele laufen als erstes Großereignis seit dem 1. und noch bis zum 30. August, zumindest bis zum Zeitpunkt, an dem ich diesen Text schreibe, ohne Corona-Alarm. Feuilleton auf und ab wird dem Festival eine Leuchtturm-Funktion im Hinblick auf künftige Kunst- und Kulturveranstaltungen zugesprochen. Aber auch andernorts wird wieder gespielt. So richtig mit mehr oder weniger Sitznachbar*innenschaft. Und mit Einnahmen-Einbußen aufgrund von Zugangsbeschränkungen. Und mit Mehr-Aufwand aufgrund von Sicherheitsauflagen. Und mit auf längere Sicht durcheinander geworfenen Spielplangestaltungen. Und mit ungeklärten Ausfalls-Tantiemen-Vereinbarungen. Und mit Absagen für junge Theatermacher*innen zugunsten großer Kassenschlager. Und mit ganz viel Planungsunsicherheit.
Auch für den zeitgenössischen Theaterjournalismus, mit dem dieser Text ja begonnen hat, stellen sich Fragen: Wie lassen sich theatrale Feedback-Schleifen konsequenter in Kritiken einschreiben? Wie reflektiere ich Plexiglas-Visiere als Kostümbild? Wie bewahre ich meine Aufgeschlossenheit in Anbetracht all der Die Pest- und Decamerone-Bearbeitungen? Und werde ich das Adabei-Geraune im Foyer jemals wieder ertragen können? Ich werde! Weil, ich liebe diesen Scheiß. Ob „Hot-Shit“ oder „Festspiele“ – Live is life.
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(30. Januar 2026)