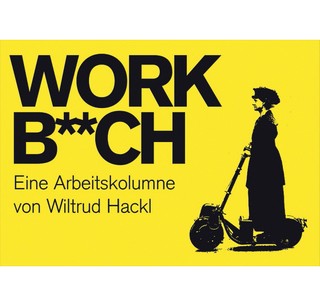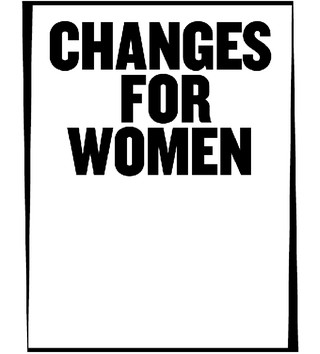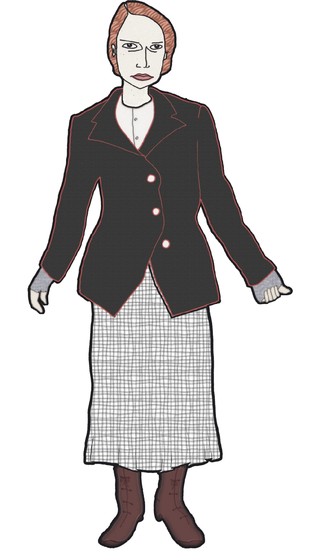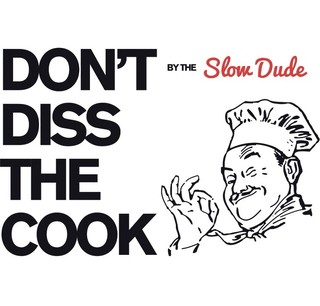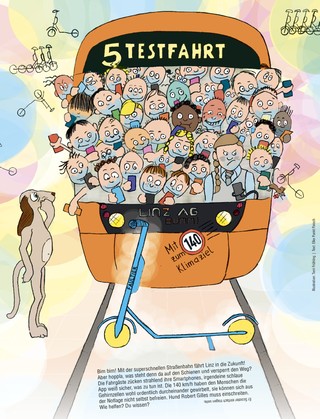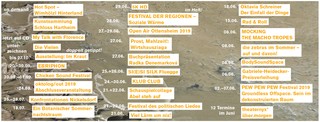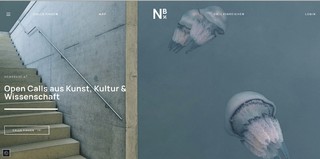Zur (Architektur-)Sprache
Die Referentin #16
Anlässlich des Todes des im März verstorbenen Dichters und Architekturtheoretikers Friedrich Achleitner schreibt Florian Huber über die ungebrochene Aktualität von Achleitners Denken.

Bild Wikimedia Commons: Anton-kurt
Seiner letzten literarischen Buchpublikation wortgesindel aus dem Jahr 2015 hat der am 23. Mai 1930 im oberösterreichischen Schalchen geborene und am 27. März 2019 in Wien verstorbene Dichter und Architekturtheoretiker Friedrich Achleitner eine Sentenz des Philosophen Fritz Mauthner (1849–1923) vorangestellt: „Sprache ist ein Werkzeug, mit dem sich die Wirklichkeit nicht fassen läßt.“ Bereits seine literarischen Anfänge im Wien der 1950er-Jahre im Umfeld des Art Club und als späterer Protagonist der Wiener Gruppe scheinen dieser Einsicht verpflichtet, wie etwa eine Lektüre des gemeinsam mit H. C. Artmann und Gerhard Rühm verfassten hosn rosn baa zeigt. Im wienerisch gefärbten Titel der 1959 publizierten Dialektdichtungen wird jene ironische Distanz gegenüber dem poetischen Sprechen und seinen Grundmotiven erkennbar, die auch für Achleitners Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Architektur zu einem stilbildenden Prinzip wurde, an deren Beginn ein Architekturstudium und das Diplom an der Meisterschule Clemens Holzmeister an der Akademie der bildenden Künste Wien stand. Als Architekturkritiker in der Abendzeitung und in Die Presse sowie in zahlreichen Aufsatzbänden widmete er sich ab den 1960er-Jahren „Problemen der Architektur […], Fragen der Architektur an Hand von Objekten“, wie es in der Vorrede zu seinem fünfbändigen, zwischen 1980 und 2010 im Residenz Verlag verlegten Hauptwerk Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert heißt. In der Verbindung von Fotografien, Konstruktionsplänen, Selbstaussagen der beteiligten Architektinnen und ihrer kritischen Beschreibung durch den Autor entstand über die Jahre eine Typologie moderner Baukultur, die trotz ihrem Fokus auf die österreichischen Bundesländer weit über nationale Kontexte hinauszuweisen vermag, wie etwa die Beschreibung der von 1955 bis 1957 errichteten Pfarrkirche am Bindermichl im ersten, 1980 publizierten Band des Architekturführers verrät: „Der parabelförmige Grundriß, die Art und Lage des Fensterbandes und nicht zuletzt die ‚zarte‘ Konstruktion zeigen eine Verarbeitung sowohl deutscher […] als auch schweizerischer Einflüsse. Ihre ‚Synthese‘ wird wohl einmal als typisch für die fünfziger Jahre angesehen werden.“ Vor allem der im letzten Satz beschworene Blick zurück verdeutlicht die besonderen Qualitäten und Herausforderungen von Achleitners theoretischer Herangehensweise an die Architektur. Die möglichst umfassende Kenntnis ihrer Geschichtlichkeit war für den Kritiker unabdingbar, zumal sich die spezifische Bedeutung vieler Bauvorhaben nur retrospektiv und in Bezug zu anderen Objekten beurteilen lässt. Sein Interesse galt daher nicht nur so genannten Landmarks, sondern vor allem auch der Alltagsarchitektur in Gestalt von Mehrzweckhallen, Industriebauten, Schwimmbädern, Kindergärten und Schulen oder Bauernhöfen sowie ihrer historischen Entwicklung, deren Spuren Achleitner unermüdlich dokumentierte, wie sein architekturtheoretischer Nachlass im Architekturzentrum Wien beweist, der zehntausende Fotografien sowie 22.340 objektbezogene und 2.690 Karteikarten zu Architektinnen umfasst. Die gleichermaßen dem Gang in die Archive und Vor-Ort-Begehungen abgerungene Materialfülle war wohl auch dem Umstand geschuldet, dass bereits zum Zeitpunkt der Entstehung des Architekturführers zahlreiche Bauwerke bis zur Unkenntlichkeit entstellt, abgetragen oder vom Abriss bedroht waren. Dem mangelnden historischen Bewusstsein gegenüber den Errungenschaften architektonischer Modernen korrespondierte die jahrzehntelange Abwesenheit einer deutschsprachigen Architekturtheorie, an die Achleitner mit seinem Vorhaben hätte anschließen können, wie er noch 1992 in einer autobiografischen Notiz mit Blick auf seinen Kollegen Gerhard Rühm bemerkt: „Ich habe ihn jedenfalls immer um das musiktheoretische Instrumentarium beneidet, dem etwa die Architektur (auf deutschsprachigem Boden) nichts Adäquates entgegenzusetzen hat.“ Die Klage über fehlende Vorbilder wurde freilich von der Einsicht begleitet, dass architektonische Denk- und Arbeitsweisen nur ungenügend im Vokabular der Alltagssprache gefasst werden können, zumal Bauwerke und ihre diversen Vorstufen nicht allein aus Worten geformt sind. Vielmehr folgt der architektonische Sprachgebrauch bis in die Bausubstanz hinein einem eigenem, aber nur selten explizit formulierten Regelwerk, wie an einem Text Achleitners „Zur Topographie und (Architektur-)Sprache Wiens“ aus dem Jahr 1994 abzulesen ist: „Auffallend ist […], daß Wien im 19. Jahrhundert, ausgerechnet in den nonverbalen Künsten, ein merkwürdiges Sprachbewußtsein, eine Sensibilität gegenüber sprachlichen Phänomenen entwickelt. Schon vor Psychoanalyse und kritischer Sprachphilosophie demonstrieren die prominenten Ringstraßenarchitekten […] nicht nur den Gebrauch unterschiedlicher Architektursprachen durch einen Künstler, sondern auch den Gebrauch ,sprachlicher Regeln‘ innerhalb der Architektur.“ So besehen vermittelt Architektur eine spezifische Weltsicht, deren Rekonstruktion und kritische Analyse nicht nur im Zentrum von Achleitners Forschungen stand, sondern auch sein literarisches Schreiben informierte, wie eine Prosaminiatur aus den 2003 erschienenen einschlafgeschichten illustriert: „heute fällt niemandem mehr auf, dass die häuser von gastein erst durch ihre aufschriften das werden, was sie vielleicht scheinen. wer könnte sonst ein hotel von einem grandhotel unterscheiden, eine villa von einem landhaus oder ein landhaus von einem haus.“ Die Rede vom Sprachgebrauch und die Thematisierung der Aufschriften an den Häusern erinnern dabei daran, dass Architektur und Literatur für Achleitner soziale Praktiken und Kommunikationsformen verkörperten, die nicht unabhängig von den an ihnen beteiligten Individuen und Räumen gedacht werden können. Auch die von ihm initiierten Debatten zum Denkmalschutz und städtebaulicher Erneuerung sowie die 2015 unter dem Titel Wie entwirft man einen Architekten? gesammelt erschienenen Essays über ArchitektInnen, vor allem aber die Überlegungen zum richtigen Standort zeugen von dieser Haltung, wie seine Darstellung der Linzer Donaulände um 1980 bestätigt: „Der Baukörper des Parkbades mit seiner signifikanten Eingangsfront ist nicht nur ein charakteristischer Bau der frühen dreißiger Jahre, sondern auch vorbildlich in seinen Dimensionen als freistehendes Objekt in der Aulandschaft. Lediglich das Brucknerhaus hat in der späteren Verbauung auf diesen Maßstab Rücksicht genommen. Die Bebauung an der unteren Donaulände hat schon längst ihren ‚eigenen Maßstab‘ geschaffen, der weder auf die Altstadt noch auf die Uferlandschaft Rücksicht nimmt.“ Im minutiösen Verzeichnen historischer Versehrungen und Versäumnisse zeigt sich die ungebrochene Aktualität von Achleitners Denken. Wer erfahren möchte, wie die Stadt und ihre Bewohnerinnen wurden, was sie heute sind, kommt an einer Lektüre seiner Schriften nicht vorbei.
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(30. Januar 2026)