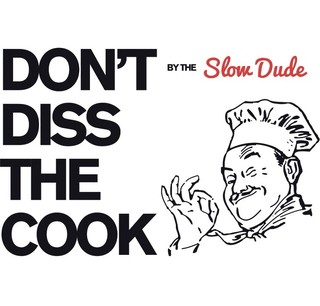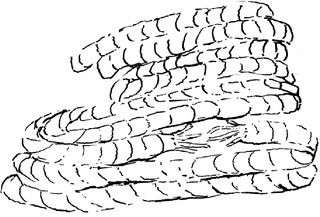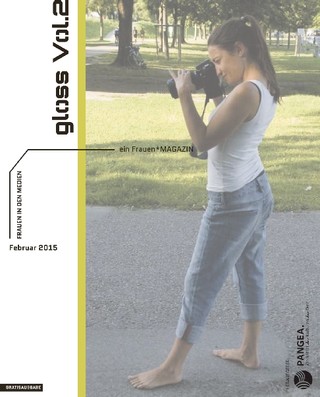Unter dem Bett flockt die Einsamkeit
Die Referentin #34
Soziale Isolation, Abkapselung, Erstarrung: Im Herbst ist Robert Stährs Buch „Plattform eins“ erschienen. Tanja Brandmayr hat es gelesen und überprüft unter anderem die cineastischen Blickperspektiven im Text.
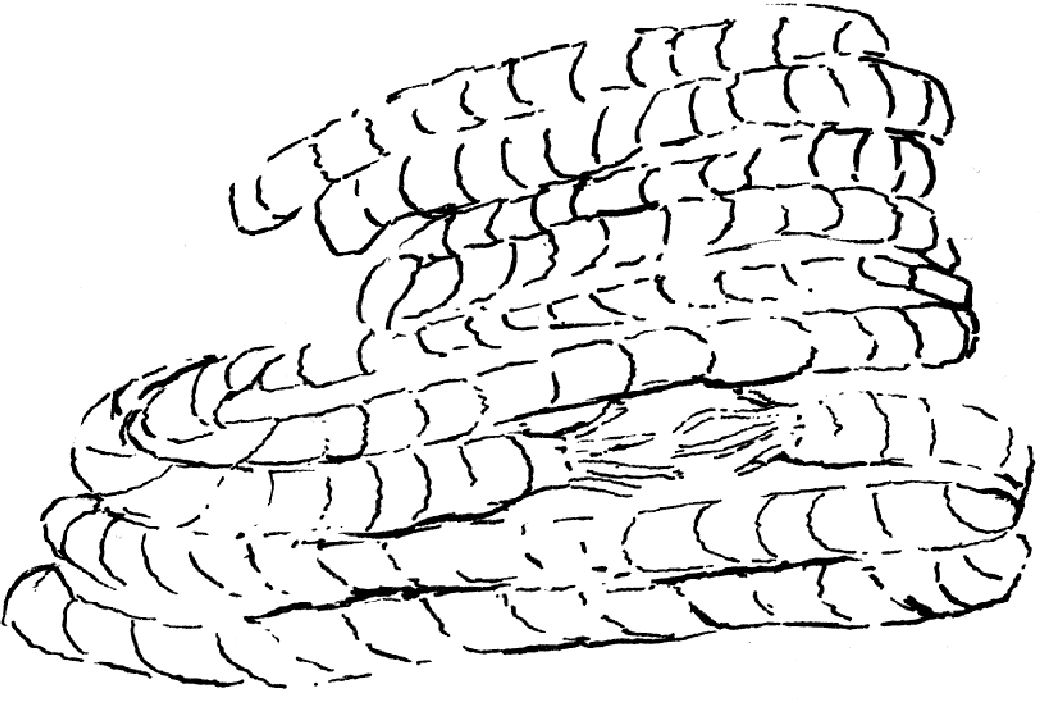
Plattform eins mit Zeichnungen von Sandra Lafenthaler. Zeichnung Sandra Lafenthaler
„Plattform eins versammelt drei Prosatexte, die aus unterschiedlichem Blickwinkel alltäglichen Schrecken beleuchten“, so der Verlagstext. Einen kleinen irritierenden Anfang setzt der Beginn mit einer singulär wirkenden Kleinschreibung des allerersten Wortes: „zwischen dem Müll wächst kein Gras.“ Weiter hinten findet sich dieser Formalismus noch einmal. Die Frage, ob diese Merkwürdigkeit einen schrägen avantgardistischen Gestus darstellt, oder höheren Eigensinn, kann nicht beantwortet werden, eventuell beides. Danach verkündet jeder einzelne Satz auf den folgenden fünf Seiten des ersten Teils eine Katastrophe, eine Art Katastrophe, vermittelt eine Stimmung, die Schlimmes erahnen lässt – oder ist zumindest schwer unheilvoll gefärbt. Die geschilderten Szenen scheinen trotz ihrer benannten Drastik in einen Alltag eingebettet, wiewohl sie fast filmisch geschildert sind: Das Auge des Beobachters „fliegt“ über Szenen draußen, durchdringt mühelos Wände (sozusagen ein „Objektiv“ als objektiver Erzähler) – und schildert knapp Menschen in Privaträumen, um dann wieder in einem Innenhof weiterzubeobachten. Passagen, wo eine Menschenmasse mehrfach „JA“ schreit, sind fraglos alarmierend, werden in ihrer schreienden Zustimmung aber nicht weiter erklärt. Hubschrauber und Hilferufe tun das ihrige zur Stimmung. Auf diesen wenigen Seiten wird vielleicht tatsächlich die wahrgenommene Realität als soziales Desaster dargestellt, oder auch nur die gängige Praxis einer Schilderung der Welt als furchtbare Gegenwart karikiert: In Literatur, Kunst, Politik oder auch bei Halsabschneider:innen sämtlicher Coleurs und Facetten ist es etwa nicht ungewöhnlich, mit Angstlust zu spielen und beim adressierten Publikum ein Gefühl von Tiefe und Zustimmung zu erzeugen. Wenngleich etwa Literatur das mit ganz anderen Intentionen macht als der gemeine Demagoge, gemacht wird es recht breitflächig in Zeiten wie diesen. Eventuell spiegeln die Sätze im Anfangsteil beides.
In Teil zwei scheint in kurzen Prosa-Absätzen eine Beziehungsgeschichte erzählt zu werden. Ein Paar lebt in einer Wohnung. Ein Ich-Erzähler kommt, geht, räumt auf, hört Geräusche (oder auch nicht), macht Bemerkungen über „sie“. Allerdings kommentiert das „Ich“ sogleich ein paar Absätze später auch „ihn“. Ob es sich um einen einfachen Perspektivenwechsel handelt oder nicht, bleibt etwas rätselhaft. Denn dieses „Ich“ beäugt zwar abwechselnd „sie“ und „ihn“, entwickelt aber irgendwie auch eigene Präsenz in der Wohnung, wie eine dritte Person. Man widmet sich dieser Frage aber nicht weiter, denn man ist mit der Schilderung von Details beschäftigt, etwa der akribischen Beschreibung von Tätigkeiten und Beobachtungen in der Wohnung (unter dem Bett etwa „flockt der Staub“). Auf verborgene Weise scheint sich ein eingeübtes Beziehungsgezerre abzuspielen. Die Ich-Person reklamiert eigenen Raum, besteht auf eigenständigem Verhalten. Erschütternd, weil offensichtlich notwendig, stehen da Sätze wie: „In der Wohnung ist kein Raum für mich tabu“. Es werden Kratzer da und dort festgestellt, kleinere Verunreinigungen. Es werden die Blicke von Nachbarn interpretiert, Rückschlüsse gezogen, es wird sortiert, etwa „die elektronische Post“, sympathisiert, kritisiert, sich distanziert. Komische Akuratesse und penibel geschilderte Nichtigkeiten erzeugen Fassungslosigkeit, aber auch Auflachen während des Lesens, während sich der Stellungskrieg in der Wohnung manifestiert. Ein stillschweigendes Agieren in definierten Territorien wie Bad, Küche, Wohnzimmer dominiert die Handlung. Es geht um erlaubtes und verbotenes Verrücken des Mobiliars, um schiefe Bilder, es wird (tatsächlicher oder eingebildeter?) Terror um Türen, Schlüssel und Absperrungen betrieben. Wieder die Frage: Wer erzählt? Es entsteht das Gefühl, dass die Frau als erzählendes Ich merkwürdig inexistent ist. Ihre auf „ihn“ blickende Ich-Perspektive wirkt bei genauerem Hinsehen wie er in seinem eigenen Außenblick. Man kann es aber nicht so recht einordnen und nimmt es weiter hin, weil man mit den fortschreitenden Abartigkeiten dieser Beziehung beschäftigt ist. Aufsperren, zusperren, einsperren. Und als sich der Protagonist im Bad seine Zehe „krebsrot“ verbrüht, ausrutscht und mit Schmerzen am Boden liegt, ahnt man gleich, wer ihm sicher nicht zu Hilfe kommen wird. Die Idee verfestigt sich, dass es sich hier nicht um ein Beziehungstheater zwischen zwei Menschen handeln könnte – sondern um ein Einsamkeitsdrama. Denn wenn sich später plötzlich zum ersten Mal die Blicke zwischen ihm und ihr kreuzen, ganz verhuscht, und sie aber dann sofort wieder hinter der Türkante hinaushuscht, sozusagen wie Norman Bates Freundin, dann stellt sich erneut die Frage, ob es sich überhaupt um eine echte Frau handelt. Oder um eine Figur, in die der Protagonist aus pathologischer Einsamkeit wie in eine Hülle schlüpft, um eine Beziehungspartnerin zu imaginieren. Und aus deren Augen heraus er sich in Folge selbst beobachtet. Ob diese Interpretation intendiert ist, oder haltlos übertrieben, dazu gibt der Text höchstens Hinweise. Und allzu lang kann man sich in diesem Rätsel ohnehin nicht aufhalten, denn im Wohnzimmer startet eine schon lange als notwendig erachtete Renovierungsaktion. Während dieser kann es zwar (abgemachterweise) keinen Einlass geben, dennoch wird „energisch Einlass begehrt“. Und irgendwann später klingt es dann tatsächlich so, als ob das Holen eines Aufsperrdienstes (fürs eigene Wohnzimmer?) als zwar unangenehme, aber immerhin in Erwägung gezogene Möglichkeit benannt wird (als „Ultimo Ratio“), sozusagen gegen den inneren Feind oder die innere Einsamkeit in der eigenen Wohnung. Gegen Ende des zweiten Teils scheint das Wohnzimmer dann unerwarteterweise tatsächlich renoviert („lindgrün“, „girlandenartige Muster“, „subtil inszenierte Ausleuchtung“). Aber die mit der Renovierung offensichtlich anvisierte kurze Hoffnung auf Überwindung von Einsamkeit wird sogleich zerschmettert: „Unsere Wohnung könnte ein Ort der Kommunikation werden, eine Art sozialer Brennpunkt hier im Haus“. Dass der in Erfüllung gegangene Wunsch nach Kommunikation, weiters nach „Frieden, offenen Türen, Freiheit“, tatsächlich mit einer „Art sozialer Brennpunkt“ gleichgesetzt wird, nämlich eventuell nach einem solchem wie im ersten Teil geschildert, und doppelt, dreifach abgesichert auch absichtlich so benannt wurde (nein, es war kein Versehen des Autors, natürlich nicht), und eine „Art sozialer Brennpunkt“ dann auch noch als „Hotspot“ bezeichnet wird, also eine Art Knotenpunkt der offenen Kommunikation, macht einen erneut staunen ob der unverblümten Umwertung der Wörter. Diese scheint auf einen Wurf radikal, frei und gleichzeitig pathologisch – quasi in einem Moment innen-nach-außen hingedreht und wie eine Bombe in die Luft geschmissen: Kawumm! Und was ist jetzt mit der Hoffnung? Natürlich kann es dann nur wieder abwärts gehen. In wenigen Sätzen werden die kleinen Verunreinigungen des Beginns zu wirklichem Schmutz, zu verpicktem Boden und schlechter Luft. Und zu Ende dieses zweiten Teils kommt die Bemerkung: „Wenigstens schützt der Dreck …“. Und man meint zu erahnen, wovor der Dreck auch schützt, nämlich vor Worten wie „sozialer Brennpunkt“, die sich als Begriffe entfremdeter sozialer Realität wie kranke Fremdkörper ins eigene Leben einnisten. Und in den Leben da und dort Schaden anrichten. Kritik an der Sprache der neoliberalen Funktionsgesellschaft klingt an, oder an der mittlerweile gängigen Praxis der völligen Uminterpretation von Begriffen.
Wer meint, dass mit dieser Besprechung über Gebühr gespoilert oder interpretiert wurde: Das musste sein, weil das Buch großartig ist! Und trotz der hier aufgeschlagenen Schilderungen bleibt das Buch interpretationsoffen und reich an Vieldeutigkeiten. Der oder die Leser:in kann selbst wiederfinden und widerlegen, was hier letztlich doch nur angedeutet sein kann. Sicher ist: Trotz seiner Kürze ist der Text erschütternd dramatisch. Mit so wenigen hingestellten Prosazeilen und einer vergleichsweise unspektakulären Handlung auf 79 Seiten eine derartig facettenreiche Fassungslosigkeit zu kreieren, den Irrwitz der einsamen Existenz quasi als cineastische Imagination zu färben, den Text gleichzeitig knapp zu halten und voller Chuzpe zu entfalten, besonders in diesen ersten beiden Teilen, das ist ob der sprachlich und umfassend perspektivisch gezogenen Register schon großes Kino.
Teil drei wechselt erneut die Perspektive. Der Protagonist reflektiert nun aus eindeutiger Ich-Perspektive seine Isolation und abgekapselte Extistenz: „Ich wohne allein, rundherum sind Menschen“.
Es entsteht insgesamt der Eindruck, dass da einer weit gegangen ist in der existenziellen Überprüfung seines literarischen Protagonisten – und einer durchaus philosophisch zu lesenden Ich-Perspektive an sich. Die absurde Genauigkeit der Analysen mäandert zwischen philosophisch-existenziellen Fragen, dem wohlwollendem Blick des denkenden und reflektierenden Humanisten, zwischen bestürzender Einsamkeit und Zurücknahme, zwischen nächtlichem Treppensteigen im Stiegenhaus und wilden Träumen von „Krokodilfluss“ und „Schlingpflanze“, verkauztem Eigenbrötlertum und der vielsagenden Beschreibung von kaum vorhandenen Blickwechseln mit Frauen. Gegen Ende spricht der Ich-Erzähler an mancher Stelle auch den Leser, die Leserin an. Er verteidigt, ohnehin immer on-the-Edge zur Nicht-Existenz, sein Dasein und seine Wohnung, in Schwebe zwischen chimärenhaftem Trugbild seines Vorhandenseins und einem echten Beobachterposten am „Fenster zum Hof“ … Nach der dramatischen Wucht der ersten beiden Teile läuft der Schlussteil jedoch aus, bezeichnenderweise realistisch und ohne Pointe, ohne Punkt und Zeichen Der Titel des Buches, „Plattform eins“ bleibt übrigens im Text unaufgeklärt. Ein Blick ins Netz und seine algorithmusgetriebenen Suchfunktionen schlägt jedoch unter dem Buchtitel „Plattform eins“ sogleich den Suchbegriff „Platttform Einsamkeit“ vor. Es handelt sich dabei um ein Angebot einer Plattform GEGEN Einsamkeit. Ah ja. Ob dies eine vom Autor intendierte Referenz ist: Auch das ist nicht sicher. Falls ja: Auch diese Referenz wäre, über den Text hinausreichend, mehr als gut gesetzt.
 Robert Stähr, Plattform eins Ritter Verlag, 2023
Robert Stähr, Plattform eins Ritter Verlag, 2023
www.ritterbooks.com/produkt/plattform-eins
Präsentation „Plattform eins“
Do, 11. Jänner 2024, Stifterhaus/Linz
Gemeinsam mit Kollegin Franziska Füchsel und Verlagslektor Paul Pechmann.
Plattform eins, Verlagstext: Plattform eins versammelt drei Prosatexte, die aus unterschiedlichem Blickwinkel alltäglichen Schrecken beleuchten. Ein Erzähler schweift wie mit einem Kameraauge ausgestattet über Straßen und Hinterhöfe, „schaut“ durch Fenster in Wohnungen und schildert von Gewalt und Zerstörung geprägte Situationen. Ein Mann und eine Frau offenbaren in alternierenden Monologen den Zustand ihrer Beziehung als paranoides Gezerre um den Zugang zu Küche und Wohnzimmer. Die selbstaffirmativen Reflexionen eines Mannes schließlich künden von finaler Erstarrung und sozialer Isolation. Feindseligkeit und Ignoranz beherrschen den öffentlichen, Argwohn und Abkapselung den privaten Raum. Robert Stähr wählt zur Darstellung solcher Befindlichkeit präzise kalkuliert stilistische Register: einen unterkühlten Beschreibungsmodus, Gesten rauschhafter Subjektivität oder eine raffinierte Dramaturgie der Spiegelung. Ein dichtes Netz an Korrespondenzen, das sich über die drei Texte spannt, macht die Dimension psychosozialer Desaster evident. Mit Plattform eins schrieb Robert Stähr ein auf faszinierende Weise gegenwärtiges Prosabuch!
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(30. Januar 2026)