Linz und der NS, wir und der NS
Die Referentin #15
Erinnerungskultur in der ehemaligen Führerstadt Linz: Anlässlich abgesagter Stolpersteine und einem neuen Gedenkprojekt hält Wolfgang Schmutz ein Plädoyer für ein herausforderndes Erinnern.



Im Erinnern an den Nationalsozialismus sollte Konsens herrschen, so meint das historisch aufgeklärte, antifaschistisch gesinnte, verantwortungsbewusste Österreich, ich nenne sie einmal: die Wohlwollenden. Das sei doch selbstverständlich, in einem Land mehr als 70 Jahre danach, obwohl, ja, mit einer zäh erkämpften Anerkennung der Opfer und einem spät erfolgten und trüben Blick auf die Täterschaft. Aber mit öffentlichen Bekenntnissen der Staatsspitzen, die, zugegeben, in der Regel umfangreicher ausfielen, als die tatsächlichen Entschädigungen oder Förderungen von Gedenkstätten und Erinnerungsprojekten. Aber immerhin. Die Mission Anerkennung sollte, gibt man sich nur ein wenig bescheiden, erfüllt sein. Aber war es jemals angebracht, hier bescheiden zu sein?
Darüber rede und schreibe ich schon ein paar Jahre. Vielleicht zu offensiv, zu ungestüm, nicht einladend genug. Jedenfalls hat noch kaum jemand öffentlich darauf reagiert. Zustimmung ist, was ich im Halbschatten ernte, was zur Seite gesprochen wird, aber nicht geradewegs in die Mikrofone. Aber auf welche Resonanz sollte meine Kritik auch stoßen, wenn die Selbstzufriedenheit, zumindest etwas bewegt zu haben, stets einnehmender ist und sich auch besser mit dem Pathos des „Nie wieder!“ vereinbaren lässt? Ein Pathos ohne Erfolge wirkt schal, und niemand müht sich gerne umsonst ab. Das gilt auch für mich, den Kritiker. Gefalle ich mir zu sehr in meiner Rolle? Öffne ich oder schließe ich Zugänge? Gehe ich zu weit, weiter als man mir folgen möchte? Worauf ich abziele, ist ein Diskurs (widersprecht mir!), jedenfalls ein Prozess, in dem möglichst viele entdecken, wie sie ihren Zugang zu einer schwierigen Geschichte finden und den Ereignissen auf den Grund gehen können. Und was es heißt, dazu Stellung zu beziehen. Ich bin der mit dem Bildungspathos.
Geschichte als Flachware und die Utopie des Erinnerns
Es geht mir aber nicht um feststehende Lektionen, wie etwa: Töten ist schlecht! Antisemitismus ist schlecht! Rassismus ist schlecht! Dazu brauchen wir den Holocaust nicht, das ist kein Lernen im eigentlichen Sinn, und das verzerrt am Ende nur das historische Bild, wie es der Didaktiker und Kurator Paul Salmons präzise formuliert. Je voreingenommener wir in die Vergangenheit blicken, desto weniger sehen wir. Tun wir es mit einer zu spezifischen Agenda, moralisch, politisch, ideologisch, filtern wir die Widersprüche heraus. Was eigentlich geschehen ist, wird zugunsten einer wohlfeilen Lektion vereinfacht, wie es genau geschehen ist, muss dafür in den Hintergrund treten. Blicken wir etwa auf Opfer, Täter*innen, Bystander, Widerständige als abgezirkelte Gruppen, als feststehende und unveränderliche Rollen? Bad guys and girls against good ones? Es ist viel komplizierter, viel komplexer als uns lieb ist, als mir lieb sein kann. Je tiefer ich in die Geschichte schaue, je mehr ich mich mit den Akteuren, ihren Entscheidungen und Handlungen beschäftige, desto verwirrter werde ich, einerseits. Andererseits erkenne ich mich mehr und mehr wieder, entdecke meine Verwandtschaft, meine eigenen Kapazitäten als Mensch.
Ich rede hier nicht von Opferschaft. Zu dieser Gruppe kann ich niemanden zählen, der zu meinen Vorfahren gehört. Und das gilt für die Allermeisten. Außerdem entscheiden die Opfer nicht, Opfer zu werden, aber Täter zu sein, dazu kann sich jede*r entscheiden. Und Täter*innen brauchen Dritte, die Täter*innenschaft ermöglichen und Opferschaft zulassen. Diese Dritten sind in der Regel die Mehrheit. Eine Mehrheit, mit der wir uns historisch aber so gut wie gar nicht beschäftigen. Wenn, dann nur als naive, jubelnde, verführte oder geblendete Masse. Nie mit Individuen, die nachdenken, abwägen, sich entscheiden, sich im Sinne der eigenen Interessen verhalten und handeln. Wir setzen uns kaum mit den Beweggründen dieser Mehrheit auseinander, mit jener Position, die wir am wahrscheinlichsten innehaben würden, die unsere Vorfahren mehrheitlich innehatten. Stattdessen widmen wir uns immer wieder den Opfern, in Bildungskontexten wie im Gedenken, wir leiten die entscheidenden und drängendsten Fragen auf sie um, und diese damit von uns selbst weg. Wir benutzen die Opfer als Totem unserer mangelnden Verantwortung und nennen es würdiges Erinnern. Ist es das? Anerkennen wir damit wirklich ihre Opferschaft? Was laden wir ihnen damit zusätzlich auf? Niemand ist dafür gestorben, dass wir Töten für schlecht halten können. Diese Instrumentalisierung der Geschichte, die Verflachung der Ereignisse und ihrer Protagonisten macht unseren Blick auf den Nationalsozialismus zur rückwärtsgewandten Utopie: So wie wir mit ihr umgehen, wird die Vergangenheit nie gewesen sein.
Zeichen und Bezeichnetes
In der Ausgestaltung des Erinnerns hat sich diese Utopie, haben sich deren Formen längst festgesetzt. Heroische Monumente gehören zum festen Inventar von Gedenkstätten. Sie suggerieren, dass KZ-Häftlinge für die Freiheit von ganzen Nationen gestorben wären, sie erzählen von der Selbstvergewisserung europäischer Länder, jeweils Opfer gewesen zu sein und lenken das Scheinwerferlicht weg von Kollaboration und Duldung. Alles ist auf das Opfererinnern zugeschnitten. Das ist per se nicht falsch, denn mit dem Anerkennen der Opfer fing es an. Das Problem ist, damit hört es bis heute meistens auch auf. Wir haben keine Form entwickelt und generell kaum eine Sprache dafür, wie wir der Täterschaft und deren Unterstützung erinnern könnten. Es schwingt manchmal mit, aber explizit, geschweige denn zu einem Fokus wird es nicht.
Jüngere Formen des Gedenkens haben sich von der heroischen Formensprache verabschiedet, künstlerische Gestaltungen machen vielschichtige Perspektiven auf. Und doch fokussieren sie nach wie vor auf die Opferschaft. Auch die Stolpersteine tun das. Ihre Stärke besteht aber darin, jene Stellen zu markieren, an denen die Opfer ihren letzten frei gewählten Wohnsitz hatten. Sie liegen vor Häusern, im öffentlichen Raum, durchsetzen und markieren, was wir nicht a priori als geschichtlich relevante Umgebung betrachten würden. Die Stolpersteine verweisen darauf, dass es in einer Nachbarschaft seinen Anfang nahm, dass die Opfer aus der Mitte einer Gesellschaft rekrutiert wurden. Sie sind ein Türöffner zu dieser Dimension der Taten. Auch wenn sie nicht ansprechen, wie die Deportationen abliefen, aufgenommen und angenommen wurden. Aber auf dieses Ausbuchstabieren käme es an.
Worüber wir nicht stolpern sollten
Trotz dieser Einschränkungen: Ich habe die Petition für Stolpersteine in Linz unterschrieben. Weil es ein dezentrales Erinnern ist, das in die Gesellschaft hineinreicht, den öffentlichen Raum bespielt und dadurch die Erinnerung an den entscheidenden Ort bringt. Ich habe unterschrieben, weil die Gegenwehr des Linzer Bürgermeisters kaum nachvollziehbar war, er durchsichtig argumentierte und dies obendrein im Brustton einer proto-autokratischen Überzeugung vorgetragen hat. Aber um ihn soll es hier nicht gehen. Die Stadt, das ist nicht ihr Bürgermeister! Die Petition half jedenfalls, es gab ein Einsehen. Und nun, da ein Gedenkprojekt beschlossen ist, wird alles gut? Nein, denn wir befinden uns nach wie vor in der Logik einer Anerkennung von oben. Das vom Bürgermeister erwartete Einlenken ist ein von ihm kontrolliertes und limitiertes: Geladene Künstler (nach welchen Prämissen?) repräsentieren ebenso wenig wie er die Stadt, und eine Jury (wie ist deren Stimmrecht gewichtet?) ist noch kein Prozess. Doch der politische Gewinn, er wird von den Initiatoren der Petition bereits eingelöst. Leider.
Nehmen wir Anteilhabe ernst, steht die eigentliche Auseinandersetzung aber erst bevor. Dabei könnte man auf rezente Zeiten zurückgreifen, in denen die Potentiale eines herausfordernden Gedenkens sichtbar wurden. Temporäre Ausstellungen und Projekte im Kulturhauptstadtjahr 2009 waren nicht nur wohlgelitten, man sorgte sich auch um das Image der ehemaligen „Führerstadt“. Es gab Konfliktstoff. Heute jedoch ist die Fassade am Brückenkopf wiederhergestellt, die Spuren von „Unter uns“ haben sich verwischt, die Stencils von „In situ“ sind verblasst. Eine vergleichbare Stadt wie Nürnberg hat sich derweil längst auf den Weg gemacht, leistet sich ein Dokumentationszentrum, renoviert den Schauplatz Zeppelintribüne und spricht nach außen wie nach innen offensiv über dieses Erbe. Den Anfang nahm alles mit einer Handvoll Geschichtestudent*innen, die damit begannen, Gruppen über das ehemalige Reichsparteitagsgelände zu führen. Heute hat der Verein „Geschichte für Alle“ über 400 Mitglieder, und ehemalige Gründer*innen forschen und gestalten im städtischen Auftrag.
Stadt der Erinnerungsarbeit?
Der Vergleich macht sicher: Linz hat immer noch einen weiten Weg vor sich. Die wiederkehrende Aufzählung bisheriger Leistungen in Sachen „Aufarbeitung“, mit der sich die Stadt zu schmücken pflegt, wandert seit über zwei Jahrzehnten via copy-paste von einem Papier zum nächsten, mit nur geringfügigen Ergänzungen. Es ist höchste Zeit, für eine Entwicklung zu sorgen, die sich wirklich fortschreibt. Aufgrund des Mangels nun für etwas Dauerhaftes wie die Stolpersteine zu plädieren, ist verlockend. Hilfreicher ist es jedoch, eine andauernde Auseinandersetzung ins Auge zu fassen. Damit diese sich verändern, ergänzen, wandeln kann.
Es geht um einen Richtungswechsel, auch perspektivisch. Als Bürger*innen sollten wir nicht darauf warten, was von oben verordnet oder genehmigt wird. Relevanz entsteht, wenn man etwas an sich nimmt, etwas vertritt und sich dazu exponiert, sich mit anderen dazu austauscht und vereinbart. Eine Stadt mag gut oder weniger gut mit Zuschreibungen leben, Bürger*innen, die etwas auf ihre gesellschaftliche Rolle halten, sollten eigeninitiativ Profile und sinnstiftende Angebote entwickeln. Die mehr als 2360 Unterzeichnenden der Stolperstein-Petition, sie könnten einen ersten Schritt in diese Richtung machen, hin zu einer Stadt der Erinnerungsarbeit. Wenn es schon ein Etikett sein soll.
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(30. Januar 2026)




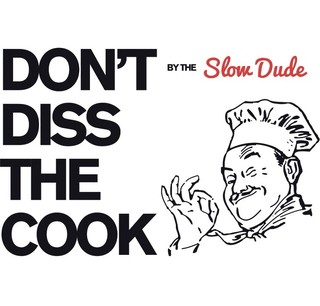




























_small.jpg)