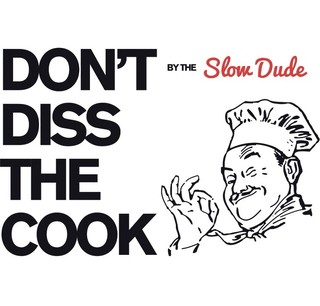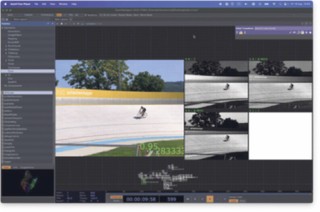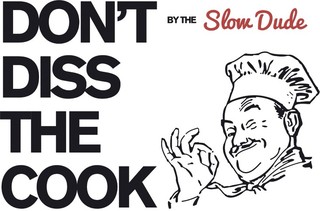Trip durch Italien: Lauter
Die Referentin #37
Im Frühjahr ist der zweite Roman von Stephan Roiss mit dem Titel Lauter erschienen. Roiss lässt seinen Protagonisten Leon zwischen Lebenshunger und Lebenskrisen durch Backstage-Bereiche laufen und nach Süden reisen. Wir begegnen Szenefreaks, der Schottischen Sinfonie, der Band God in Trouble, dem Dübel als non-binärem Kunstprojekt und so weiter. Eine Empfehlung für ein Buch, das sich vielfach liebend, rauschhaft und verzweifelt mit dem Leben in Beziehung setzt. Ein Textauszug.

Das könnte Protagonist Leon in Italien gesehen haben. Foto Stephan Roiss
Manchmal kam ich zu einem Bahnhof und hatte bereits ein Ziel, manchmal nahm ich den nächstbesten Zug, egal, wohin er fuhr. Ich stand an Straßenrändern und hielt Kartonschilder hoch. Ich stand in Menschenschlangen und wünschte mich fort. Ich kaufte mir in Turin einen Rucksack, überließ meinen Koffer samt einem Gutteil meiner Kleidung einer Wahrsagerin, wanderte so lange, wie mein Bein es zuließ. Ich versäumte Busse. Ich kurvte auf einer Vespa im Slalom durch eine Pinienallee. Ich ließ meine Finger durch das Seewasser gleiten, die harte Kante eines Ruderbootes in meiner Achsel. Ich streckte meinen Kopf aus dem Fenster des Taxis, schloss die Augen. Die letzten Monate
sollten von mir abblättern wie sonnenverbrannte Haut, und der Fahrtwind sollte sie mit sich reißen, über Wald und Flur verstreuen, auf Nimmerwiedersehen. Es gab einen Tag,
an dem ich auf Pappdeckeln lag und das schwache Licht eines Kondomautomaten mir die Nachttischlampe ersetzte. Es gab einen Tag, an dem ich unter einem Luster erwachte, der so breit war wie ein Wagenrad, und ich über einen spiegelblank gewischten Korridor in einen Frühstückssalon schlenderte, wo kolorierte Kupferstiche an den Wänden hingen und ein Grammophon knisterte. Über dreckige Zimmer beschwerte ich mich nicht. Wozu, morgen würde ich ohnehin wieder weg sein. Ich verschickte Fotos von beidseitig abgebrochenen Kleiderhaken, schimmelnden Duschvorhängen und fingerlangen Kakerlaken und zeichnete einen Blitz in die Staubschicht auf der Minibar. Ich folgte ersten
Eingebungen und ergriff letzte Möglichkeiten, gab der Versuchung nach, berauschte mich am Tempo, an Tollheiten, silbernen Lippen, Seeluft, Cynar, nur um eine Stunde später von der Tristesse sinnloser Freiheit ins Kissen gedrückt zu werden. Selber Mond, andere Stadt. Ich wollte der bleiben, der nicht bleiben muss, und wünschte mir doch nichts mehr, als dass irgendetwas bleiben darf: das diffuse
Morgenlicht und die graublauen Gassen, das Mädchen, das die Taubenfeder in den Tautropfen tauchte und die Luft damit beschrieb. Ich wünschte mir, dass alles gewesen sein wird, auch das Vergebliche und Herzzertrümmernde. Ich dachte alles immer schon
vom Ende her, küsste einen bronzenen Dichter nach einer Nacht voll träger Träume, die sich nicht dazu hatten durchringen können, von etwas zu handeln, setzte mich auf die Hafenmauer, sah die Sonne aus der Ungewissheit hinter dem Horizont auftauchen und hörte bald den Akkord, in dem ich das Glühen der Wolkenbänke aufbewahren wollte, den sanft surrenden Sound, ein langsames Glissando. Das Geschrei der Möwen gab mir die Idee einer Rhythmik ein. Ich übersetzte mir das Glitzern des Wassers in ein Geriesel hoher Töne und die Adriafrachter in satte Basstrommelschläge. Ich notierte eine Melodie auf der Rückseite einer Fahrkarte. Jede Note war Bestandteil
eines aussichtslosen Unterfangens. Der Zerfall der Wirklichkeit dauerte an. Manchmal träumte ich davon, ein Theaterstück zu unterbrechen, die Spielenden und das Publikum des Saales zu verweisen, um danach allein, ungestört, durch das Bühnenbild zu wandeln. Es gäbe keine Handlung mehr, keine überraschende Wendung, kein Drama, nur eine Anordnung von weißen Steinen. Strahlig gestreifte Patellen
hafteten an der Kaimauer. Vor dem Blumenladen standen kübelweise Rosen und ein Stufentisch mit hellgrünen Setzlingen. Im bunten Sortiment des Eissalons gab es schon mittags tiefe Gräben, geschürft von Löffeln aus Edelstahl. Knorriger Blauregen wand sich um die schmalen Säulen des Cafés, und der Hund auf der Schwelle wirkte ausgestopft. Auf gestärkten Tischtüchern lagen Speisekarten, dick wie Lyrikbände. Im Park am Vorplatz des Bahnhofs schliefen Schutzbefohlene unter goldglänzenden Folien. Eine Dame in Lila drehte langsam ihren Lippenstift heraus. Ein Bub zog einen Spazierstock aus dem Müll und ließ ihn über die Vergitterungen der Kellerfenster rattern. Auf meine Pizza legte sich der Staub, den die Baumaschinen aufgewirbelt hatten. Ich erkannte
ionische Säulenkapitelle in den dünn geschnittenen Champignons und im Brokkoli die Bäumchen, zwischen denen Vaters Modelleisenbahn hindurchgesaust war. Ich erkannte in gefleckten Bananenschalen das Fell von Geparden. Ich erfreute mich an den wilden Blumen neben dem Gleis und schlief im Zug an der Schulter eines sanftmütigen Fremden. An den Gott meiner Mutter
glaubte ich schon lange nicht mehr, und die Leerstelle, die er hinterlassen hatte, ließ ich verwuchern. Berauscht von den Farben und Düften der Kräutergärten kehrte ich zum Fluss zurück,
in dem in brauner Plastiklatzhose ein Fliegenfischer stand, ein Vater die Füße seines Kindes wusch, auf einem Felsen eine Frau ihr langes rotes Haar kämmte. Ein Schild wies die Grünfläche hinter dem Maschendrahtzaun als Militärzone aus. Ich entdeckte dort bloß zwei Rutschen und ein Vogelhäuschen. Abends betrank ich mich unter einer Kiwilaube mit dem glücklosen Fliegenfischer, spielte auf seiner Hammondorgel einen alten Björk-Song, verfolgte die Schatten der Wolken auf den gewaltigen Berghängen, bis es dunkel wurde. Die Äste waren angeschwollen, hatten die Rinde zum Platzen und das weißgelbe Fleisch zum Vorschein gebracht. Die Platane verstellte mir den Blick auf den Mond, ließ mich wissen,
dass sie sich vor dem Mond befand und der Mond hinter ihr. Nichts war selbstverständlich, auch nicht, dass die Dinge sich zueinander ins Verhältnis setzen. Eine Steinhütte mit wuchtigem Schieferdach
kauerte zwischen Brombeersträuchern und Brennnesseln in einem zerfurchten Hang. Vor Jahrzehnten war der Efeu eingezogen und mit ihm die Leopardennattern. Unter einem Haselnussstrauch rostete eine Badewanne. Im Wald war der Kot der Tiere rot von verzehrten Beeren. Greifvögel schwebten über dem Talkessel. Ich griff zum Schürhaken und verrückte ein Scheit, damit das Feuer
besser atmen konnte. Muss ich mir Sorgen machen? ‒ Nein, das musst du nicht. ‒ Bist du dir sicher?‒ Nein. Aber danke, Milena, dass du bist, wie du bist. Siebenschläfer hielten mich
wach. Der Nachbar bestrich seinen Lattenzaun mit saurer Milch und bot mir Kaffee aus zerriebenen Eicheln an. Unten im Dorf trank ich Hagebuttentee aus dünnwandigen Porzellantassen und Liköre mit kitschigen Aromen. Die Wirtin kraulte mir den Bart und fragte mich Vokabeln ab. Der Raum bot mir ein Zuhause,
einen Platz im großen Gefüge. Die Zeit lehrte mich das Fürchten. Vio hatte mich immer dafür ausgelacht, aber ich ertrug das Ticken eines Metronoms nur, wenn sich Musik darüberlegte. An der Steilküste
Liguriens, zwischen grünen Bergen und dem offenen Meer, drängten sich pastellfarbene Häuser. Im Hafen des Fischerdorfes schaukelten Boote auf den Wellen, und auf dunklen Klippen sonnten sich Touristen. Ich saß auf einer Anhöhe unter einem Bambusdach, sah das Blut der Maulbeeren an den Händen der Kinder und currygelbe Nikotinflecken an meinen. Die Möwen legten sich in den Wind, der weiter unten
den Staub der Küstenpfade aufwirbelte. Hatte ich früher einen schönen Ort gefunden, hatte ich mir vorgenommen, noch einmal hierher zurückzukehren, nun dachte ich mir: Vielleicht bin ich zum letzten Mal hier. Ich wurde von der Polizei verscheucht,
als ich mit erhobenem Daumen an der Autobahnauffahrt stand, und von zwei alten Damen zu einer Runde Scopa und einem Stück Zitronenkuchen eingeladen. Ich schlich mich in einen Campingplatz ein, übernachtete im Zelt einer tschechischen Buchhalterin, die mir mit einem Feuerzeug die Haare an meinen Oberarmen abfackelte, marschierte am nächsten Morgen durch einen vier Kilometer langen Arkadengang zu einem Heiligtum, um mitzuerleben,
wie das Fell einer Kuh im Schatten die Farbe von Rost annahm. Straßenkünstlerinnen tanzten mit Spazierstock und Melone zu französischen Chansons, als gäbe es keine Marsmissionen, keine Trollfarmen, keine Rasenmäherroboter. Jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wurde,
brach die Musik lautstark aus dem Lokal. Das Schwarzlicht trieb die Graffiti aus den Wänden heraus und ließ alles Weiße erstrahlen: Papier, Zähne, die Schuppen auf den Schultern. Die Bewegungen der Tanzenden wurden vom Stroboskop in Einzelbilder
zerhackt. Mögen wir alle Elefantentode sterben: lebenssatt die Stunde erkennen ‒ es ist gut, dass ich hier war, es ist gut, dass ich jetzt gehe ‒ und uns in die Wellen legen, unter einen alten Baum, an ein Herz, das uns gewollt hat. An einer Raststätte
kurz nach Bologna sah ich, wie Fernfahrer ihre Pornohefte tauschten, und im Kuppelmosaik des arianischen Baptisteriums zu Ravenna Jesu Penis von den Fluten des Jordans umspült. Vor jeder Schiebetür machte ich eine Wischbewegung mit der Hand,
als wären mir die Dinge hörig. Anton hatte sich zu einem Münztelefon bequemt und mir eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen: Der Wanderer möchte dich kennenlernen. Volltrunken schrieb ich ihm eine Mail mit vier Worten: Fick dich, du Honk. Die Stadt war nicht ewig,
nur uralt, für mich aber so neu, dass ich mich in ihr verirren konnte. Wo man einst das Blut glückloser Gladiatoren getrunken hatte, um die Epilepsie zu bekämpfen, trug man heute Ohrringe in Form kleiner Chili-Schoten und richtete Honigmelonenstücke und dünne Speckstreifen auf weißen Tellern an. Auf dem Weg zum Areal einer Weltausstellung, die nie stattgefunden hatte, leerte sich die Metro, die Halteschlaufen schaukelten, in den Kurven kollerten leere Plastikflaschen über den Boden, Koffer fielen um, Reisende hielten ihre Rucksäcke fest. Ich stieg aus und fand versteinerten Faschismus vor. Dunkler Harn verriet mir,
dass ich zu wenig trank. Ich verbrachte einen Abend mit wässrigem Bier und technoidem Blues, einer flüchtigen Bekanntschaft und dem hartnäckigen Eindruck, dass ich an diesem Abend glücklich war. Auf dem Display erschien der Buchstabe V. In manchen Momenten
kannte mein Zorn auf Vater kein Erbarmen. In anderen Momenten rührte mich diese groteske Tollpatschigkeit: Er hatte seinem Sohn, der nichts mehr von ihm wissen wollte, nur irgendwie helfen wollen. Insekten
verschwanden in den Falten ergrauter Bettlaken. Sie hatten mehr Beine als ich, machten jedoch nicht den Eindruck, als hätten sie mehr Gedanken. Ich stand um Mitternacht
vor einem Haus und nippte Limoncello, vernahm das Schnarren der Zikaden und sah jenseits der Felder aberhunderte Lichter ferner Ortschaften flimmern, und bald war es, als ob das Schnarren und das Flimmern zusammengehörten ‒ das Geräusch der Unsichtbaren und das lautlose Bild: Es schnarrten die Lichter. Ich war verliebt in die vielen Tiere,
die wilden Hunde, die mich beim Spazierengehen zur Umkehr zwangen, die Viper, die sich vor mir über den Steinweg schlängelte, das Pferd, das an einer Grasnarbe schnoberte, mit seinen Lippen Halme abraufte und mit dem Schweif nach Fliegen schlug, die Ringelkröten, die sich bei Schlechtwetter unter dem Khakibaum versammelten. In einer Nacht, in der uns viele Sternschnuppen versprochen worden waren,
sah ich ein Stachelschwein durch die Altstadt von Olevano wackeln. Was an der Hausmauer haftete, warf im Lichtstrahl meines Telefons bizarre und monströse Schatten: die Zangenbeine einer Gottesanbeterin, zwei kleine Skorpione und winzige Schnecken ohne Zahl. Als ich meine Zigarette in ein Glas fallen ließ, in dem sich Regenwasser gesammelt hatte, zischte es,
und ich fragte mich, was es war, das da zischte, dieses Es, von dem die Sprache behauptete, es existiere.
Stephan Roiss: Lauter
Roman, Jung und Jung, Salzburg 2024
jungundjung.at/lauter
Lesetermine
Stephan Roiss mit Lauter:
13. September 2024
Mit Musik von Gigi Gratt
OKH, Vöcklabruck
19. September 2024
/w Tanja Paar, Harald Schwinger
Dinzlschloss, Villach
08. Oktober 2024,18:30 h
Steiermärkische Landesbibliothek, Graz
17. Oktober 2024, 19:30 h
Gastzimmer, Eferding
/w Ferdinand Schmatz, Richard Wall
16. November 2024, 19:00 h
/w Karin Peschka, Corinna Antelmann
ARTifex, Zwettl/Rodl
24. November 2024, 13:30 h
BuchWien
3sat-Lounge, Wien
28. November 2024
Mit Musik von Gigi Gratt
KAPU, Linz
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(30. Januar 2026)