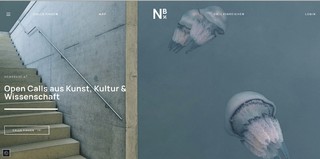Editorial
Die Referentin #39
Das Wort K.-o.-Tropfen ist ein umgangssprachlicher Sammelbegriff für über 100 Substanzen. Anlässlich der aktuellen Kampagne SO WHAT?! #notyourfault schreibt Rebekka Hochreiter über Gewalt und Missbrauch in Verbindung mit Betäubungsmitteln. Die chemische Unterwerfung ist kein schöner Einstieg ins Editorial, aber ein notwendiger – bitte die Kampagne weiterverbreiten. Zu viele skrupellose Menschen sind unterwegs und ganz generell: Zu viele Wenig-Nachdenker:innen haben wieder ihren Oberguru gefunden. Oder wie es Mar Pilz in ihrer Kolumne ausdrückt:
Jedes Mal, wenn ich denke, die Menschheit könne nicht noch dümmer werden, passiert etwas, das mich vom Gegenteil überzeugt. Trump ist wieder an der Macht – als hätte jemand die Tür zu einer heruntergekommenen Kneipe aufgestoßen, nachdem er sein Abendessen ausgekotzt und auf dem Weg dorthin auch noch seine Würde verloren hat.
Sie wechselt vom Bildhaften zum Literarischen, wenn sie in ihrem Text über den 8. März ein Land beschreibt, in dem Demonstrationen verboten sind. Sie meint Nicaragua, wenn sie schreibt:
Es wundert mich nicht, dass der magische Realismus in Lateinamerika geboren wurde – denn wie sonst sollte man diese Realität beschreiben? Man muss Lateinamerika erleben, um es zu verstehen. Überall kann Macondo sein.
Sie meint Gabriel García-Márquez’ dystopischen Ort der Gewalt, wo alles Unvorstellbare passieren kann. Die in ihrem Text vorgestellte und aus Nicaragua stammende Marycow ist übrigens am 8. März in der Stadtwerksattt zu sehen – Fiftitu% und Stadtwerkstatt rufen nach der Demo zum internationalen Kampftag ebendorthin.
Ebenso literarische Bezüge sind in Dominika Meindls Antworten auf Fragen zur politischen Geisterbahn zu finden. Sie meint zuerst auch recht bildhaft:
Irgendjemand hat uns in eine entgleisende politische Geisterbahn gesetzt. Die eine Hälfte juchzt vor entgrenztem Vergnügen, die andere ist nahe dran, sich vor Entsetzen zu übergeben. Ein Urfahraner Jahrmarkt des Grauens. Eine Ent-Geisterbahn im Missvergnügungspark.
Bevor sie in Science-Fiction übergeht. Demnach fühle sie sich immer öfter wie Marvin, der depressive Android aus Per Anhalter durch die Galaxis. Er weiß alles, deswegen ist er demoralisiert:
I’d by far rather be happy than right.
Ja, die Literatur … möchte man dazu sagen. Wir verweisen auf die vielen großartigen Textbeiträge unserer Autor:innen insgesamt. Bitte machen Sie sich selbst ein Bild. Wir möchten uns hier zum Abschluss noch auf folgendes beziehen:
Der Kulturrat Österreich, der Zusammenschluss von Interessenvertretungen in Kunst, Kultur und freien Medien, macht darauf aufmerksam, dass auch nach dem gescheiterten ÖVFP-Regierungsbildungsversuch viele Probleme, mit denen Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen konfrontiert sind, weiterhin ungelöst sind. Weiterhin bleibt die budgetäre Lage ungewiss, Kürzungen auch des Kulturbudgets stehen im Raum. Weil die soziale Absicherung in diesem Feld seit Jahren Lücken aufweist und weil Fair Pay gerade erst begonnen hat, fordert der Kulturrat eine Fortführung dieses Prozesses. Es braucht definitiv Erhöhungen im Budget. Diese Botschaft somit an die neue, nach langem Ringen formierte Bundesregierung Österreichs. Bleibt zu hoffen, dass auch die Klimapolitik nicht komplett unter die Räder kommt. Und es wird auch hier nichts anderes übrig bleiben, als dass die überlebensnotwendigen Maßnahmen eingefordert werden.
Mit diesen Worten
und einem Zitat aus Karla Kolumnas Text, der wiederum den lieben Wiesengrund referenziert
Und dann denke ich daran, dass wir uns weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen sollen
und übrigens auch mit einer neuen Referentin-Webseite auf www.diereferentin.at
grüßen
die Referentinnen,
Tanja Brandmayr und Olivia Schütz
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin




edgar-honetschla%CC%88ger_medium_small.jpg)
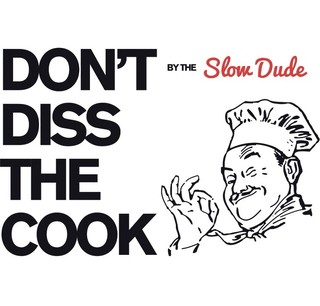





_small_small.jpg)