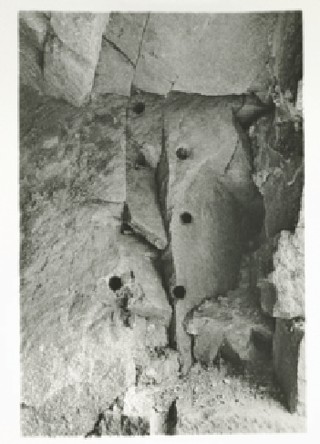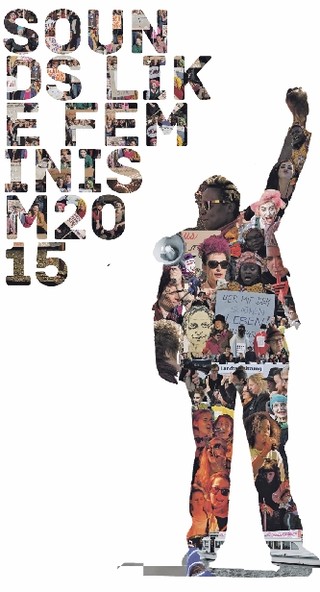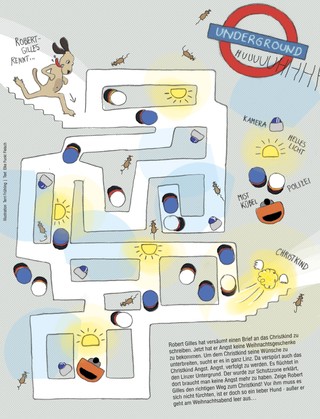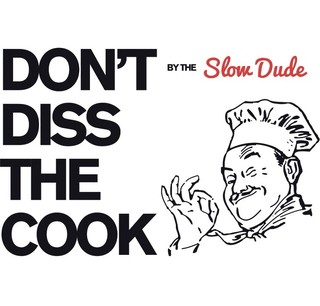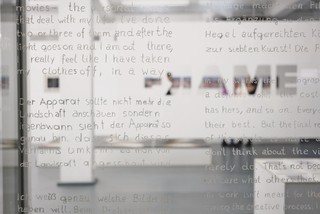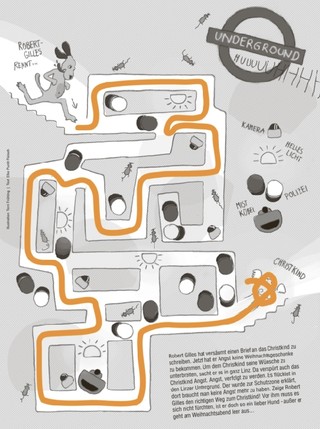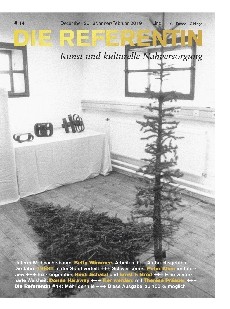Von Harpyien, Menschen und anderen Tieren
Die Referentin #14
Schon beim ersten Blick auf Teresa Präauers neues Buch wird klar: Wir haben es hier mit einem Mischwesen zu tun. Ines Schütz über Tier werden von Teresa Präauer.

Der Einband scheint aus Fell zu sein, blau-rotbraun gefleckt. Kein Leopard, kein Jaguar – aber eindeutig Fell, fast möchte man es im Drüberwischen ein klein wenig streicheln. Klappt man den Umschlag dann auf, schimmern unter dem Fell Schmetterlingsflügel hervor, zeichnet sich im Fell das Muster von Schmetterlingsflügeln ab, so genau lässt sich das nicht sagen. Als „Schreckzobel“ wird das, was wir in Händen halten, ausgewiesen, und spätestens jetzt, in den Händen, fühlt sich der Einband freilich glatt an. Darunter oder dazwischen ein Essay mit dem Titel Tier werden und während man noch überlegt, wie das, ob das überhaupt gehen kann, hört man den Text schon: „Am offenen Fenster sitzend höre ich die Geräusche, die von draußen hereinkommen. […] Im Nachbarhaus beginnt ein sehr kleines Kind zu quengeln, und je länger es jammert, umso stärker verwandelt sich sein Weinen sonderbarerweise in das Singen eines Kuckucks, das die Kinderstimme bald ganz übertönt.“
Diese Menschen-Vogelstimme klingt noch im Ohr, da führt einem der Text schon ein Bild vor Augen, eine Harpyie, die unter anderem in der Aeneis eine nicht unbedeutende Rolle spielt. In einer Naturkunde aus dem 17. Jahrhundert hat dieses Mischwesen, so Präauer, „ein skeptisches, nicht unfreundliches Gesicht und trägt eine Frisur aus langen buschigen Locken, die, leicht hinters Ohr geschoben, bis zur Mitte des Körpers reichen – zur Mitte eines Vogelkörpers nämlich, dessen helles Gefieder zum Rücken hin dunkler und dichter wird.“ Dass sich Mischwesen in der Literatur von der Antike bis heute tummeln, ist bekannt, für die bildende Kunst gilt Ähnliches. Aber dass sich die Abbildung einer Harpyie in einem als Naturkunde ausgewiesenen Buch findet, erstaunt. Genau das hat Teresa Präauer als Ausgangspunkt für ihren Text genommen und sich auf eine beinahe kriminalistische Spurensuche begeben. Am Beispiel der Harpyie und anderer Mischwesen zeigt sie auf, dass die Trennung zwischen Mensch und Tier genauso unscharf ist wie die zwischen Biologie und Literatur, auch wenn wir heute viel darauf verwetten würden, klare Grenzen ziehen zu können.
Schon in früheren Texten erweist sich Teresa Präauer als Grenzgängerin, allerdings nicht mit dem Ziel, den Unterschied zwischen „hier“ und „dort“ herauszustreichen, sondern ihn zu relativieren und die Grenze gleich mit aufzuheben. In ihrem Debütroman Für den Herrscher aus Übersee aus dem Jahr 2012, für den sie mit dem aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet worden ist, sind Erinnerungen zugleich eine Fantasie über das Fliegen. In Johnny und Jean (2014), einem Roman über zwei Kunststudenten, wird die Grenze zwischen den beiden Protagonisten nach und nach durchlässiger und in Oh Schimmi (2016) macht sich die Hauptfigur im wahrsten Sinne des Wortes zum Affen. Es ist nur konsequent, wenn Präauer die Antrittsvorlesung ihrer Samuel-Fischer-Gastprofessur für Literatur an der Freien Universität Berlin (2016) Tier werden nennt und auch ein Seminar mit dem Titel Poetische Ornithologie – zum Flugwesen in der Literatur hält.
„Die Harpyie bleibt im Übergang, sie entscheidet sich nicht“, so Präauer in ihrer Vorlesung, die dem gleichnamigen Essayband zugrunde liegt. Tier werden, das bedeute eben auch, kein Tier zu sein, sondern sich im Übergang zu befinden, und Ähnliches gelte für die Literatur, „dieses Mischwesen, dessen wir nicht habhaft werden können“. In einem Interview zu ihrem Essayband sagt sie: „Wenn man sich wünscht, Aussagen über die Welt zu treffen, die eindeutig sind, wird man dem Kern der Dinge nicht näherkommen. […] Das heißt nicht, dass alles schwammig ist und verrätselt, sondern dass Denken ein Prozess ist. Es gibt immer mindestens zwei Möglichkeiten und ein Drittes, das dazwischen ist, an dieses Dritte habe ich mich gewandt, sozusagen.“
Diesem Dritten spürt sie nach, wenn sie sich fragt, was ein System wie die Taxonomie von Carl von Linné, das Mitte des 18. Jahrhunderts sprachlich die Natur ordnet, mit Linguistik oder Literatur zu tun hat. Was die Darstellung von Mensch und Tier sowie dazugehörige Einordnungsversuche über den Blick auf die Welt aussagen. Warum Fabel- und Mischwesen so lange Zeit Teil der Biologie und als Erdrandbewohner auch der frühen Kartografie gewesen und wann sie in die Abteilung „Fiktion“ abgewandert sind. In diesem Denk-Prozess nimmt sie uns mit auf eine Reise durch die Welt der Kunst und Biologie, der Perchten und des alpinen Karnevals, durch eine Sammlung von Bildern, Texten und Filmen, in denen zottelige Figuren oder Mischwesen eine Rolle spielen und das von vor 1000 Jahren bis jetzt. „Die Form, die Teresa Präauer ihrem Untier an Text verliehen hat, widerspiegelt dessen Programmatik. Eine ungezähmte Form des Denkens, mäandernd zwischen Dürer, Hofmannsthal und Pokémon, zwischen Sarah Kofman, Furries und Deleuze/Guattari (von deren devenir-animal Präauer dann auch ihren Titel abgeleitet hat), tritt einem da entgegen“, schreibt Philipp Theisohn in der Neuen Zürcher Zeitung. „Gelehrt wäre sicherlich der falsche Name für solch ein rauschhaftes, kluges und schönes Gebilde. Dieses Buch will nicht belehren. Es will Beute machen.“
Literatur an sich ist darauf aus, Beute zu machen, folgt man Teresa Präauer in ihren Überlegungen, und diese Beute heißt Verwandlung: „Sobald wir ein Buch aufmachen, lassen wir uns auf diese Fiktion ein, werden Teil des Leseprozesses, der Protagonisten, der Figuren.“ Ziel ist hier nicht der oder die Verwandelte, sondern der Verwandlungsprozess an sich, die Offenheit dafür, ihn immer wieder neu in Gang zu setzen. Genauso ist es mit dem Tier-Werden. Es ist eine Denkbewegung, die das „Dazwischen“ auslotet: „Wo der Mensch das Tier sprechen lässt, in Kinderbüchern, in Comics, ist es der Mensch, der spricht. Mit verstellter Stimme erzählt er, was er denkt, wie es denn wäre, eine Fledermaus zu sein, ein Kater oder ein Käfer“, so Präauer in einem Interview und „Wenn der Mensch über Tiere nachdenkt, denkt er eigentlich unbewusst über sich nach und über seine Konzepte davon, was Welt ist.“
Dass Tier-Werden nicht darauf abzielen kann, Tier zu sein, legt auch unser derzeitig gültiges Verständnis von Welt nahe, biologisch gesehen sind wir es nämlich schon längst: Der Mensch „hat bis zu 99 Prozent genetischer Übereinstimmung mit den Schimpansen und Bonobos“, schreibt Präauer, „und teilt sich mit ihnen dieselben Vorfahren. Der DNA-Vergleich mit jedem anderen mehrzelligen Lebewesen ergibt übrigens immer mindestens 25 Prozent an identischen Sequenzen, also auch eine Verwandtschaft zwischen Mensch und Karotte.“
Über Geräusche entlässt uns dieser Text wieder (die Grenze zwischen Mündlichem und Schriftlichem wird ohnehin auch viel zu eng gezogen), das quietschende Japsen einer winzigen neugeborenen Katze oder doch das Brummen einer Hummel begleiten Gedanken über die entfernten Gemüse-Verwandten, das Urvieh, das in allem wohnt, irgendwo auch in uns. Und beim Zuklappen das Buch vielleicht doch noch einmal ganz sanft streicheln – wer weiß?
Teresa Präauer: Tier werden.
Wallstein Verlag, Göttingen 2018.
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(30. Januar 2026)