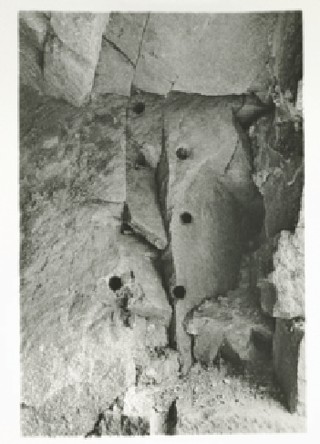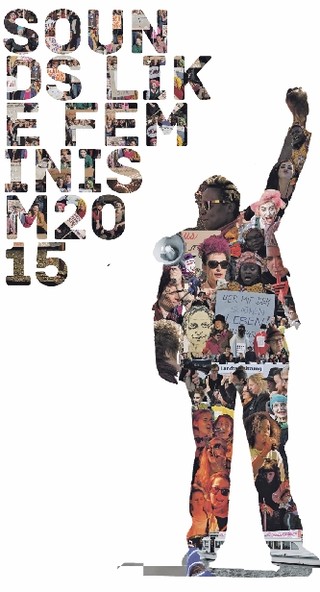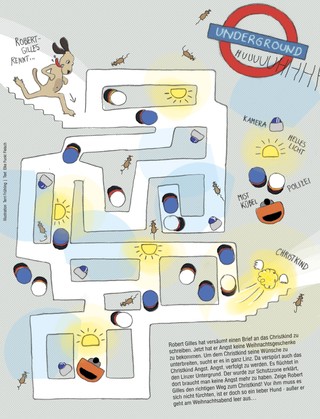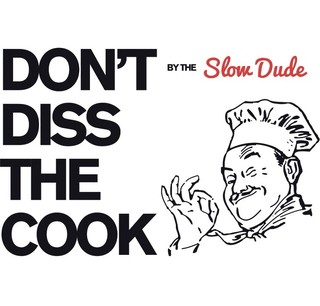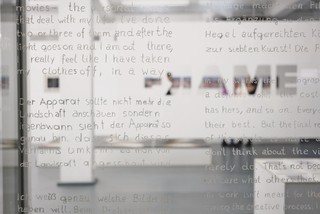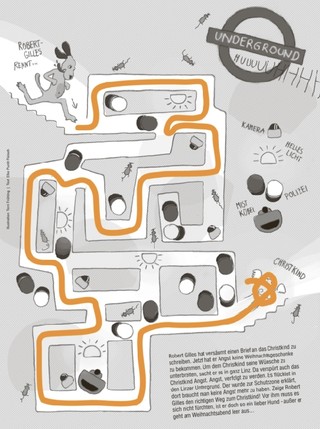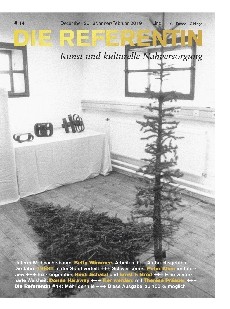Macbeth (Rekonstruktion)
Die Referentin #14
„Macbeth“ – der Kresniksche Tanztheaterskandal von 1988 wurde 30 Jahre später am Landestheater Linz wieder inszeniert. Theresa Gindlstrasser über die Provokation von damals und die Inszenierung von heute.

Der feierliche Umgang mit Gedärmen und Blut. Foto Dieter Wuschanski
Berserker! So nannten sie ihn. Und nennen ihn noch. Johann Kresnik, 1939 in Kärnten geboren, wurde 1968 von Kurt Hübner ans Theater Bremen geholt, wechselte 1988 nach Heidelberg. Dort entstand im selben Jahr die zum Theatertreffen nach Berlin eingeladene Arbeit „Macbeth“. Mit Bühnenbild von Gottfried Helnwein und Musik von Kurt Schwertsik. Drei Österreicher im Regie-Team. Von 1993 bis 2002 leitete Kresnik die Tanzsparte an der Volksbühne Berlin. Dort choreografierte Kresnik 2015 eine seiner aktuellsten Arbeiten, „Die 120 Tage von Sodom“ nach Marquis de Sade und Pier Paolo Pasolini.
Gewalt, Faschismus, Sex, Politik – Kresnik variiert seine Themen minimal. Dezidiert politisch und links will er seine Arbeiten verstanden haben: „Ballett kann kämpfen“. Als einer der wenigen männlichen Pioniere des deutschen Tanztheaters hat er die Szene mit seinen großen, blutigen Körperexzessen herausgefordert. Mei Hong Lin, Leiterin der Tanzsparte am Landestheater Linz, initiierte bereits in ihrer Zeit am Theater Darmstadt die Rekonstruktion zweier älterer Kresnik-Arbeiten: „Ulrike Meinhof“ und „Sylvia Plath“. Für das Musiktheater in Linz wurde nun, 30 Jahre nach der Uraufführung von Kresniks prominentestem Stück, „Macbeth“ rekonstruiert.
Rekonstruiert wie? Nach altem, wackeligem Videomaterial wurden sowohl die Dimensionen der Bühnenbauten berechnet, die choreografischen Abläufe nachgebildet, als auch die Kostüme geschneidert. Christina Comtesse, Lins Stellvertreterin am LTL, war damals, 1988 in Heidelberg, als Tänzerin bei „Macbeth“ dabei und übernahm für Linz die Einstudierung der Choreografie. Die Rekonstruktion der Bühne kommt von Sabine Hainberger. Es geht los vor geschlossenem roten Vorhang. Die beiden Pianisten Bela Fischer jr. und Stefanos Vasileiadis sitzen auf einer trockenen Insel im sonst blutgefüllten Orchestergraben und bringen das Klavier zum Klirren.
Die Menge an Theaterblut beeindruckt. Bei jedem Todesfall – und bei „Macbeth“ von Shakespeare gibt’s derer ja einige – pumpen Schläuche, die sich über Wände winden, mehr davon nach vorne ins Becken. Schaut ranzig aus. Ganz im Kontrast zum steril weißen Raum, der sich nach hinten verjüngt. Übermenschen-großes Eisentor mit knallendem Riegel öffnet sich: Eine schwarz gekleidete Figur – der Tod, ein Priester, eine Putzkraft – jedenfalls mit Blackfacing, schreitet Richtung Rand des Orchestergrabens und entleert Kübeln, Badewannen voll von Requisiten-Gedärmen. Ein klares Setting jedenfalls: Rot, weiß und schwarz, das ist Schneewittchen-Farbschema, das Schema der großen Kontraste, immer beliebt bei großen Themen.
Ein Artikel in der Presse zitierte Kresnik, der bei den Proben am LTL teilweise anwesend war: „Not so slow“ und „schneller, schneller“. Der Umgang mit Gedärmen und Blut ist tatsächlich derart feierlich geraten, dass sich anstatt provokantem Ekel eher ein Gefühl der Langeweile breitmacht. Überhaupt die Frage: War Kresniks „Macbeth“ auch 1988 so gediegen? Wahrscheinlich eher nein. Sehgewohnheiten haben sich verändert, Tanzgeschichte und Realgeschichte schreiben sich weiter und so weiter und so fort. Die kompetenten Körper des Linzer Tanzensembles nähern sich der damals gegen bloße technische Kompetenz und Perfektions-Hierarchie entwickelten Choreografie von Kresnik.
Da gibt es: Akrobatik, Anstrengung und Präzision, Schweiß und Messer. Das Ensemble meistert körperlich anspruchsvolle, knappe zwei Stunden. Sonderbar sauber wirkt das Geschehen, so gewollt, so abgesichert. Mit ausdruckslosen Gesichtern vollführen die Tänzer*innen die assoziativen Gewaltbilder. Einzig Andressa Miyazato, seit der Spielzeit 2013/14 im Ensemble am LTL, tanzt die Rolle der Lady Macbeth mit einer einsamen Entrücktheit. Was sie vom restlichen Ensemble unterscheidet, ist ihre Mimik. Da hat sich jemand, auch schauspielerisch, in den Wahnsinn der Lady Macbeth hineingeworfen und eine berauschende, soghafte Figurenzeichnung vollbracht.
Nach und nach schält sie sich aus ihrem roten Kleid, Miyazato lässt es zuerst wie eine unwillkürliche Alltags-Geste wirken, bis es dann, manischer und manischer, zum Versuch der Befreiung vom Blut, von den eigenen vollbrachten Handlungen wird. Lady Macbeth – immer beliebt, sie als großen Bösewicht zu inszenieren – wird bei Miyazato zu einer vielschichtigen Figur. Dieser Ambivalenz kommt weder das restliche Ensemble nach, noch überhaupt scheint’s der clean-und-tidy-Rekonstruktion an ein wenig Unwägbarkeit gelegen zu sein. Die mit dem Namen „Kresnik“ assoziierte inszenatorische Wucht verpufft in sauber aufgeräumten Klischees. Zum Beispiel plakativ: Die drei Hexen, die dem adligen Heerführer Macbeth eine Zukunft als König prophezeien, lassen diesen von ihren Brüsten Blut saugen. Es flößen also die Frauen, den durchwegs als Kindsköpfen gehaltenen Männern, die Lust an der Gewalt mit der Muttermilch ein. Frauen, Verführung, Sex, Gewalt – ach, eine alte Leier. Die Kindskopf-Männer hingegen spielen mit Messern, werfen sie gegen Badewannen, hüpfen in übergroßen Stiefeln durch den Raum, metzeln einander hin, als wäre es ein Spiel.
Macbeth mordet zum Beispiel Duncan, den König. Der eine Mord ermöglicht ihm zwar den zeitweiligen Besitz der Königskrone, macht aber weitere Morde zum Erhalt derselben notwendig. Die Familie vom Gegner Macduff soll ausgelöscht werden. Weiß gekleidete, mit Prothesen verkleidete Ärzte, Wissenschaftler, Forscher laufen ins mit überdimensionalen Möbeln verstellte Kinderzimmer ein. Die Kindskopf-Kinder von Kindskopf-Mann-Macduff stecken in pastellfarbenen Schlafanzügen, das ist ein Bruch mit dem Schneewittchen-Schema.
Um den Gewaltbildern von Kresnik folgen zu können, ist es hilfreich, sich den „Macbeth“-Stoff zu vergegenwärtigen. Zwar sind die Protagonist*innen alle da, vieles gestaltet sich aber eher assoziativ, als stringent. Klar ist: Es geht um Gewalt, ein Blutrausch. Aber: Auch Macbeth ist am Ende hin, er liegt in einer Badewanne. Vorhang von der Seite und eiserner Vorhang von oben schließen sich, verengen die Perspektive auf Macbeth in der Wanne. Schaut – bei gut gelegenem Sitzplatz – aus wie „Die Ermordung des Marat“, Jean-Louis Davids berühmtes Bild von 1793. Referenziert aber auch auf den Tod des deutschen Ministerpräsidenten Uwe Barschel im Jahr 1987. Das war ein Jahr vor der Premiere von „Macbeth“.
Gewalt, Faschismus, Sex, Politik – das Arbeiten mit konkreter politischer Aktualität provozierte 1988 Bombendrohungen. Die Rekonstruktion des einstigen Bürgerschrecktheaters ist von tanzhistorischem Interesse. Auf der Höhe der Zeit bewegen sich die im Landestheater inszenierten und zudem etwas zu clean wirkenden, opulenten Bilder jedoch nicht. Das, was kritisiert werden soll – Gewalt und Blutrausch – wird in seiner Darstellung wiederholt und weitergetragen. Damit reicht’s jetzt dann mal.
Macbeth ist noch bis Februar im Landestheater Linz zu sehen.
Letzter Spieltermin: 17. Februar.
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(19. Januar 2026)