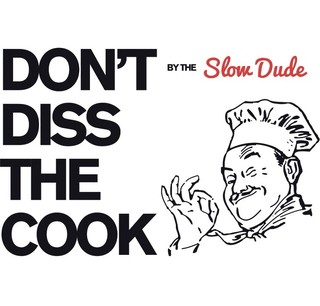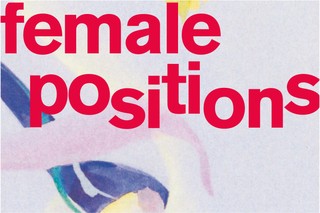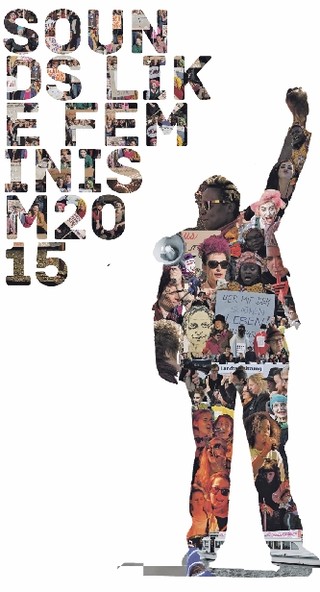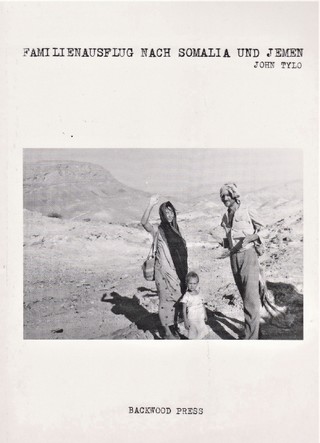Longing for Home, Schwabo
Die Referentin #31
Im Februar wurde der Film Longing for Home von Meinrad Hofer im Kliscope gezeigt, der ein Performancestück von Silke Grabinger zum Thema hatte. In beidem geht es um kulturelles Erbe, Tradition, Vermächtnisse, Verstrickungen, Flucht und die Geschichte der Donauschwaben – und um ein Sehnen nach einer verlorenen Heimat. Wenn ich Heimat höre, haben viele zuvor schon ihren Revolver entsichert, meint Tanja Brandmayr dazu.

Filmstill Longing for Home.
Der etwas unter 50minütige Film Longing for Home entstand im Zuge des Performanceprojekts Someone from Home. Das mehrteilig angelegte EU-Projekt zum Thema kulturelles Erbe war in Serbien, Rumänien, Bulgarien und Österreich angesiedelt. So setzt sich die Linzer Company SILK Fluegge in diesem Performanceprojekt „mit den Donauschwaben auseinander, die in den Gebieten Vojvodina (Region in Serbien), Banat (zwischen Serbien, Rumänien und Ungarn geteiltes Gebiet) und Bačka (in Serbien und Ungarn) leben, mit deren Geschichte, deren sozialem Gewebe sowie deren traditioneller Kultur“. Im Zuge dessen ist der begleitende Film Longing for Home von Meinrad Hofer entstanden, er wurde 2022 fertiggestellt und jetzt im Februar erstmalig gezeigt.
Was das Tanzperformanceprojekt betrifft, bestanden die Ebenen der Auseinandersetzung aus Volkstanzelementen, etwa zu live gespielten Gstanzln, sowie aus zeitgenössisch tänzerisch bis skulptural performativ wirkenden Settings zu elektronischer Musik. Das Stück involvierte Textfragmente auf der Bühne, die etwa auf Nationalismen referenzieren. Und das Stück zeigte sozusagen traditionell donauschwäbische als auch künstlerisch gestaltete Kostüme, ein mit Orden absurd übervoll dekoriertes Kostüm als Repräsentation der Monarchie; oder ein Kostüm mit Gewehren im schwarzen Tüll-Unterrock: Es symbolisierte Maria Theresia, die einerseits Schutz offerierte, andererseits einst die Menschen zur Absicherung der Grenzen und Gebiete in die Ferne geschickt hatte. Schutz und Kampf, diese Assoziationen führen dann im Doku-Film hin zu Massakern des Zweiten Weltkrieges, an denen Donauschwaben beteiligt waren. Aber zuerst zum Stück: Im Rahmen der Aufführungen wurde in Österreich und an öffentlichen Plätzen in Südosteuropa performt und es wurden Begegnungsmöglichkeiten zwischen anwesenden Menschen inszeniert, als emotionales und in Verbindung tretendes Element. Das Interesse war, der eigenen und gemeinsamen Geschichte als Volksgruppe nachzuspüren, als Element der Begegnung, Beteiligung und des gemeinsamen Tanzens. Der Film zeigte dies in Impressionen und montierte Proben, Aufführungen und Statements zur Intention und Entwicklung des Stückes zusammen. Dazu sprach vor allem die Donauschwaben-Nachfahrin Silke Grabinger, zum Tanz und der Authentizität der Bewegungsrecherche kam Company-Mitglied Gergely Dudás zu Wort. Diese an sich schon reichhaltige thematische Basis wurde im Film Longing for Home mit Oral-History-Elementen von Menschen ergänzt, die als Vertreter:innen der älteren und jüngeren Generation gerade wegen der wenig aufgearbeiteten Donauschwaben-Geschichte die jeweiligen Probe- und Aufführungsorte quasi wie von selbst zu finden schienen (O-Ton Regisseur: „Sie waren einfach da“).
Was vermutlich genau die Absicht des Projekts war – auch besonders in der Eigenschaft als Angebot auf Kommunikation. Es fanden Interviews statt, die von Meinrad Hofer gefilmt wurden, außerdem Gespräche mit Nachfahr:innen der Volksgruppe der Donauschwaben in Österreich. Gemeinsamer Grundton: den Donauschwaben geht es zwar irgendwie gut, aber es handelt sich oft um ein Leben zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um eine gefühlte Leere zwischen Historie, Nationalitäten und dem eigenen Schicksal. Vor allem, was die jüngere Zeitgeschichte anbelangt, handelt es sich oft um ein Totschweigen. Man beziehe sich da geschichtlich lieber auf die Monarchie, so eine Interviewte. In den Gebieten hatte man immerhin in der Regel kaum Probleme miteinander, das Zusammenleben der verschiedenen Gruppen war „normal“. Dafür wurde man an entscheidenden Punkten der Geschichte umso brutaler instrumentalisiert. Im Film gab es etwa eine erschütternde Aussage über die Begeisterung von jungen Männern für die Nazi-SS, man durfte als junger, kriegsbegeisterter Donauschwabe etwa nicht zur Wehrmacht. Die Begeisterung legte sich mit den ersten Kriegstoten schlagartig. Oder ein Nachfahre erzählte vom Vater, der als SS-Mann nur wenige Tage nach Eintreffen in Ausschwitz ein Gesuch auf Versetzung an die Front abgab – er hatte bis dahin Auschwitz für einen großen Truppenübungsplatz gehalten. Was soll man dazu sagen? Der Film berichtete, dass in Serbien Donauschwaben an Massakern beteiligt waren, zigtausende von ihnen selbst getötet wurden und gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wieder auf der Flucht nach Österreich und Deutschland waren. Mehrfach blitzt auf, wie komplex die Geschichte dieser Volksgruppe ist, wie ambivalent und wie unzureichend bewältigt – persönlich, individuell und kollektiv, als Spielball der nationalen und kriegerischen Interessen.
Neben einer Oral History beziehungsweise Zeitzeug:innen-Interviews erzählt der Film in einem längeren Teil als Stimme aus dem Off, und als eigentlicher Kern, die persönliche Herkunftsgeschichte, die Sehnsucht nach der eigenen Geschichte, dem Fremdsein und dem Longing for Home, über das Leid der Vorfahren, deren Suche nach Glück. Im O-Ton, um einen Eindruck zu geben: “My ancestors were sent by Maria Theresia to move to the Banat. They find themselves under a variety of people, a multiethnic state. (…) What they are able to carry, they carry with them. The land is very hard to farm. (…) A mixture between surviving and rebirth of a new home.”
Oder in Analogie zum tänzerischen Medium, nochmals Monarchie, Maria Theresia und deren Absicht, die Siedler als Schutzwall zu verwenden: “It was a politically well rehearsed choreography against the Ottomans”. In diesem erzählerisch-reflektierenden Abschnitt sind verschiedene Aufführungen mit tradierten und zeitgenössisch tänzerischen Elementen zu sehen. Die Stimme aus dem Off reflektiert weiter die persönliche Nachfahrinnen-Seite und den emotionalen Versuch, zwischen Heimat, Flucht, Vertreibung und Schuld die Geschichte der Vorfahren zu verstehen, auch von Seite des Tanzes und dessen Bedeutung: “They dance because they can. They dance because you can be in touch with someone. Words are not needed”. Oder von den Brüchen: “From one moment to the other there is a separation. (…) A weird exciting feeling to go to war (…) Out of tune.”
Die Erzählerin Silke Grabinger ertappt sich unter anderem in einer Komplizenschaft der Gesten, der tatsächlichen und symbolischen Steps, die gelernt werden müssen, auch wenn sich diese unter anderem gegen die eigenen Nachbarn richten: “It is my duty to make the steps, to defend my family (…) even if that means that my neighbour is my enemy”.
So werden Familiengeschichte, Zeitzeuginnen-Interviews, der Tanz als künstlerisches Medium sowie ein reflektierender Text zusammengeführt. Im Text zum Film heißt es etwa: „Dabei sind Fragen nach der Tradierung der Geschichte und den möglichen Auslassungen wichtig.“ Womit wir bei Fragen nach den Auslassungen des Dokumentarfilms selbst angelangt sind: Der Film setzt Interviews von Zeitzeug:innen und Nachkommen als Mittel ein. An die Stelle der komplexen politischen Faktenlagen oder dementsprechenden historischen Expert:innen-Stellungnahmen, setzt er weitgehend die künstlerische Dokumentation eines Tanzperformanceprojekts, das selbst von Leere und Auslassungen handelt. Der Dokumentarfilm wechselt etwa ab der Mitte zu einer essayistischen Erzählung. Diese thematisiert Abgetrennt-Sein und ein Wieder-in-Verbindung-Kommen. Gegen Ende des Filmes wird ein “everlasting longing for home” benannt: “We try to reconnect again (…) to fill the missing puzzles (… ) the void”.
Bei mir als Zuseherin bleibt die Faszination übrig, wie tief sich Familiengeschichte immer wieder über Generationen manifestiert. Andererseits bleibt zwischen Krieg, Massaker, Flucht und zwischen Gesten, Kostümen, Tanz, Text und Musik im Film eine gewisse Leere übrig: Zweifelsohne sind Tanz und Musik superpotente Mittel, auch in diesem Kontext. Und ich empfinde sogar Mitleid für Menschen, die das Potential von Kunst herunterspielen. Vielleicht gerade deshalb hätte ich mir im Film noch eine andere Involvierung der Donauschwab:innen verschiedener Generationen gewünscht, abseits herkömmlicher Interviews. Ich kann mir zwar vorstellen, dass das in diesem Setting schwer machbar gewesen wäre, und will das in dem Sinn nicht als Kritik verstanden wissen. Aber es bleibt für mich eine gewisse Unverbundenheit. Es bleibt eben ein Gap, vielleicht für mich als nicht-donauschwäbische Betrachterin in Form offener Stellen, vielleicht für Nachfahren und Nachfahrinnen als offene Wunden – oder als Sehnsucht nach bauschigen Röcken, Erzählungen der Großeltern oder nach den Gerüchen der Kindheit.
„Wie soll ich tanzen, wenn ich net amal a Stückl Brot hab?“, sagt an einer Stelle eine ältere interviewte Dame im Film. Und ich frage mich: Wie soll ich Fragen zu Volksgruppen und Heimat thematisieren, oder an ein Re-Connecten glauben, wenn Ermordete sich nicht mehr connecten können. Mir ist dann beim Nachdenken spontan der Satz eingefallen: „Wenn ich Heimat höre, haben viele zuvor schon ihren Revolver entsichert“ – und ich meine damit: Wer auch immer heute über Heimat spricht, muss wissen, dass dafür schon viele Waffen entsichert wurden. Und für eine psychopathische Idee von Heimat wurden von den Nationalsozialisten nicht nur Gewehre und verrückte Emotionen entsichert, sondern es wurde systematisch und akribisch der Massenmord in den Gaskammern organisiert. Geschehnisse, Beschädigungen, die überlagerten Emotionen, Schuld, Auslassungen bis hin zu den Vorteilen, die sich Menschen durch den Anschluss an „die Deutschen“ versprochen haben. Das ist aber wiederum eine Geschichte über die Geschichte der Donauschwaben hinaus, die alle oder sehr viele betrifft, die ihre Familiengeschichten betrachten – als Täter, Mitläufer und als Nachfahren-Bewohner:innen der Grauzonen in den Braunzonen.
Und dann stellt sich noch die Frage: Wie soll man dann noch tanzen? Das Problem hat Adorno schon ähnlich festgestellt.
Am Ende fällt mir noch das kurze Gespräch zu Beginn der Filmvorführung ein. Eine Bekannte berichtet, dass sie von Jugendlichen im Zuge einer Auseinandersetzung mit der Thematik zuletzt so angesprochen wurde: „He, du Schwabo, … äh Entschuldigung, … Sie Schwabo!“ Wir haben gelacht, ich kannte den Ausdruck nicht. Ich wusste auch nicht, dass sie Donauschwäbin ist, was mir im Sinne einer Festschreibung auf Identitäten auch völlig egal ist. Die Thematisierung von Herkunft und Tradition ist noch einmal eine ganz andere Diskussion. Aber ich kenne die undurchdringliche Gemengelage von Familie, Traumatisierungen und die immer unzureichenden Bewältigungsstrategien. Und denke: Gerade deshalb muss die Kunst ran. Und gerade deshalb sind Lücken in Kunstprojekten nicht nur schwer in Ordnung, sondern auch gut.
Das Film-Screening war am 17. Februar 2023 im Kliscope zu sehen.
Im März ist außerdem im Kliscope in der Glimpfingerstraße 8 die Produktion Pygmalion Nullpunktzwei zu sehen, siehe Referentinnen-Tipps am Ende des Heftes.
www.silk.at
Redaktionell geführte Veranstaltungstipps der Referentin
(30. Januar 2026)